Études

Bericht im Auftrag Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
Swiss Economics hat zusammen mit Arioli Law die Eignerstrategie Swisscom des Bundes evaluiert. Wir sind u.a. zum Schluss gekommen, dass heute weder für die Sicherstellung der Grundversorgung noch für den Ausbau des Hochbreitbandnetzes ein hinreichend starkes öffentliches Interesse an einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes an der Swisscom besteht. Die Erbringung dieser Leistungen erfolgt mehrheitlich im Wettbewerb oder kann hinreichend gesetzlich geregelt werden. Ein sicherheitspolitisches Interesse an einer Mehrheitsbeteiligung kann bestehen, wenn die notwendigen Leistungen nicht ausreichend über die Gesetzgebung und/oder kommerzielle Verträge gesteuert werden können. Letztlich ist für die Beibehaltung einer Mehrheitsbeteiligung eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse und einer allfälligen Gefährdung der Wettbewerbsneutralität vorzunehmen.
Michael Funk, Urs Trinkner, Lukas Bruhin, Martina Arioli, Nicolas Oderbolz, Nina Schnyder

Wie wirken sich bestehende und mögliche Regulierungen der Temporärarbeit auf einzelne Stakeholder und die Gesamtwirtschaft aus?
swissstaffing, der Dachverband der Schweizer Personaldienstleister, sieht die Branche derzeit mit verschiedenen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Swiss Economics hat im Auftrag von swissstaffing eine Studie verfasst, welche die Auswirkungen bestehender und möglicher Verschärfungen der Branchenregulierung aufzeigt. Dazu wurden auch die wichtigsten Stakeholder befragt um die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, einzelne gesellschaftliche Gruppen und die Gesamtwirtschaft zu untersuchen. Das Analyseschema orientiert sich dabei an der Regulierungsfolgenabschätzung (RFA), die von der Verwaltung zur Evaluation von Regulierungen durchgeführt wird.
Autoren: Michael Funk, Seline Spillmann, Nicolas Oderbolz

Gutachten im Auftrag des Verband Immobilien Schweiz VIS

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur
Swiss Economics hat zusammen mit SUMICSID und dem IAEW den Effizienzvergleich der Verteilernetzbetreiber Strom der vierten Regulierungsperiode durchgeführt. Im Fokus stand wiederum die Abbildung der netzseitigen Kosten der Einbindung dezentraler Erzeugung. Der von der Bundesnetzagentur publizierte Schlussbericht umfasst alle wesentlichen methodischen Aspekte und dokumentiert die Resultate. Beim Effizienzvergleich werden rund deutsche 200 Netzbetreiber hinsichtlich ihrer Kosteneffizienz verglichen.

Studie für santésuisse
Per Ende 2023 wurden dem Bundesrat die beiden Vorschläge neuer Tarifsysteme für ambulant-medizinische Leistungen zur Genehmigung vorgelegt, welche den in die Jahre gekommenen TARMED ersetzen sollen. Ziel des vorliegenden Berichts ist es, die Vorzüge von ambulanten Pauschalen zu identifizieren und zu würdigen.
Autoren: Urs Trinkner, Tobias Binz, Eva Zuberbühler, Seline Spillmann, Nicolas Oderbolz
Zur Studie: Santesuisse-Webpage

Besteht Anpassungsbedarf bei der Bestimmungsmethodik des WACC für Schweizer Stromnetzbetreiber? Wie sollte der WACC für Erneuerbare festgelegt werden?
Unsere Empfehlungen für Anpassungen an der StromVV-Methodik für die Bestimmung des WACC Netz und Förderinstrumente Erneuerbare umfassen die Aufhebung der Unter- und Obergrenzen für den risikolosen Zinssatz, die Einführung eines TMR-Ansatzes und die Einführung von Möglichkeiten zur Überprüfung, Veränderung und Korrektur der Peer Group. Zur Studie...
Autoren: Tobias Binz, Urs Trinkner, Romain de Luze, Leah Meyer, Elena Zarkovic, Michael Altorfer

Studie für das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Swiss Economics hat eine umfangreiche Analyse des Strommarktes im Rahmen der Strukturberichterstattung des SECO durchgeführt. Die Analyse zeigt, wie sehr Stromverbraucher auf Preisveränderungen reagieren und wie die nachfrageseitige Flexibilität verbessert werden kann. Die wichtigsten Erkenntnisse wurden in einem Artikelbeitrag der Volkswirtschaft veröfffentlicht.
Autoren: Nicolas Eschenbaum, Urs Trinkner, Lilia Habibulina, Maida Sabotic, Romain de Luze, Leah Meyer de Stadelhofen
Zur Studie: SECO-Webpage
Zum Volkswirtschaftsartikel: Deutsch, Französisch

Studie für das Bundesamt für Energie (BFE)
Swiss Economics unterstützt das BFE im Rahmen der Arbeiten am neuen Gasversorgungsgesetz. Vor dem Hintergrund wurde eine Studie verfasst, um zu untersuchen, ob der im neuen Gesetz geplante Marktgebietsverantwortliche (MGV) neue Aufgaben im Bereich der Versorgungssicherheit übernehmen soll und was für Folgen dies für den Entflechtungsbedarf, die Governance und die Kapitalisierung hätte.
Autoren: Urs Trinkner, Lukas Bruhin, Michael Funk, Tobias Binz, Nicolas Oderbolz, Josef Winkler
Zur Studie: BFE Seite

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur
Der Bericht dokumentiert die für die vierte Regulierungsperiode vorgenommene relative Referenznetzanalyse (RNA) der deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB).

Grundlagenstudie für das AWEL des Kantons Zürich
Im Rahmen eines ergebnisoffenen Grundlagenberichts wird aufgezeigt, was die Heimfallstrategien der Standortkantone sind und welche Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken damit einhergehen. Vertieft werden dabei insbesondere auch Fragestellungen im Bereich der Investitionsanreize und der Governance.
Autoren: Urs Trinkner, Claudio Burkhard, Nicolas Eschenbaum, Leah Meyer de Stadelhofen

Studie im Auftrag des Bundesamtes für Energie (BFE)
Der Bericht dokumentiert die Ergebnisse aus einem Projekt zur Quantifzierung der Erlösmöglichkeiten verschiedener Typen von
Wasserkraftwerken. Auf der Basis einer detaillierten Erlösberechnung der verschiedenen Absatzmärkte werden Heuristiken abgeleitet, die das Bundesamt für Energie bei der künftigen Umsetzung der gleitenden Marktprämie verwenden kann.
Autoren: Nicolas Greber, Alexander Fuchs, Nicolas Eschenbaum, Urs Trinkner
Zur Studie: BFE-Webpage

Studie für das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE)
Geistiges Eigentum, beispielsweise in Form von Patent- oder Urheberrechten, schützt Erfinderinnen und Erfinder vor Trittbrettfahrern und schafft damit Anreize, verstärkt in Forschung und Entwicklung sowie in kreative Werke zu investieren. IP ist auch für den sich stark entwickelnden Bereich der Blockchain-Technologie und –Anwendungen relevant. Das IGE wollte durch unserer Studie den aktuellen und vor allem auch den künftigen Bedarf an IP-Dienstleistungen besser einschätzen. Eine ähnliche länderspezifische Studie wird zurzeit auch in Singapur durchgeführt und später veröffentlicht.
Autoren der veröffentlichten Publikation: Dr. Samuel Rutz, Matthias Hafner, Felix Wüthrich, Beatrix Marosvölgyi
Unsere Studie finden Sie hier (nur auf EN verfügbar).

Grundlagenpapier
Das Grundlagenpapier zur schweizerischen Daten- und Digitalpolitik erarbeitet in einem ersten Schritt eine ökonomisch gestützte Terminologie und Konzeptualisierung des Themas. Darauf aufbauend erfolgt eine Charakterisierung digitaler Märkte und ihrer Regulierung. Als Resultat entsteht ein Framework, um Ursprung und Auswirkungen von Herausforderungen in der Digitalpolitik ökonomisch zu analysieren. Der Framework wird auf die aktuellen politischen und regulatorischen Initiativen in der Schweiz und der EU angewendet. Hieraus werden Empfehlungen abgeleitet.
Autoren: Lukas Bruhin, Nicolas Eschenbaum, Matthias Finger, Urs Trinkner

Studie für das Institut für Geistiges Eigentum (IGE)
Im Zusammenhang mit der Revision des Urheberrechtsgesetzes wurde Swiss Economics vom Institut für Geistiges Eigentum beauftragt, eine Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) zur Einführung eines rechtlichen Schutzes für journalistische Leistungen im Internet durchzuführen.
Autoren: Dr. Matteo Mattmann, Dr. Michael Funk, Dr. Samuel Rutz, Dr. Nicolas Eschenbaum, Beatrix Marosvölgyi

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur
Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor (Xgen) ist ein wesentliches Element der Anreizregulierung. Im Gutachen von WIK Consult und Swiss Economics wird der Xgen auf der Grundlage der Törnqvist-Methode und der Malmquist-Methode geschätzt.

Bericht zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung des EV Zug
Swiss Economics hat in einem Bericht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des EVZ untersucht.
Autoren: Michael Funk, Samuel Rutz, Andreas Stritt, Larissa Jenal, Luca Apreda

Gutachten im Auftrag der Commission for Aviation Regulation
Wir bestimmen die Höhe der Kapitalkosten des Flughafens Dublin unter Berücksichtigung jüngster Entwicklungen im Aviatiksektor und auf den Finanzmärkten. Hierbei handelt es sich vornehmlich um den Einfluss, den die Covid-Pandemie und die erstarkte Inflation auf Risikoempfinden der Investoren und risikofreie Zinssätze hatten.
Autoren: Tobias Binz, Matteo Mattmann, Lilia Habibulina, Luca Apreda
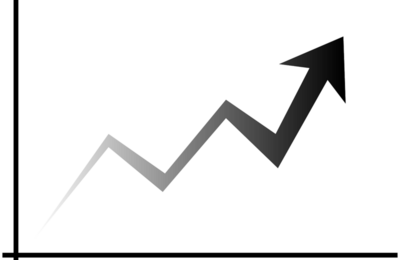
Was für Massnahmen gegen hohe Energiepreise wurden auf Ebene EU und Schweiz eingebracht? Welche davon könnte die Schweiz ebenfalls umsetzen?
Im Auftrag des BFE hat Swiss Economics eine Studie zu möglichen Massnahmen des Bundes gegen hohe Strom- und Gaspreise erstellt.
Auf der Grundlage des Berichts hat der Bundesrat am 21. Dezember 2022 das weitere Vorgehen der Schweiz beschlossen (zur Medienmitteilung).
Autoren: Urs Trinkner, Nicolas Eschenbaum, Romain de Luze, Luca Apreda, Nicolas Greber

Wie können die systemischen Risiken Terror und Pandemie abgesichert werden?
Systemische Risiken wie Terrorismus und Pandemien können zu hohen finanziellen Verlusten führen. Gleichzeitig stellt die eingeschränkte Poolbarkeit systemischer Risiken eine große Herausforderung für ihre Absicherung dar, wofür es jeweils risikospezifische Ursachen gibt. Aufbauend auf einer Analyse der Herausforderungen sowie Instrumente zu ihrer Begegnung werden unterschiedliche Handlungsoptionen zur Verbesserung der Absicherung deutscher Unternehmen vor den finanziellen Schäden durch Terrorismus und Pandemien entwickelt und anhand der Kriterien Umfang der Absicherung, Anreizwirkung, Effizienz und Auswirkung auf den Staatshaushalt bewertet.
Autoren: Christian Hott, Ann-Kathrin Crede, Eva Zuberbühler, Samuel Rutz, Romain de Luze
Das Gutachten wurde im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) verfasst. Hier geht es zur Kurzfassung.

Welche Massnahmen des Bundesrates und der Kantone waren während der zweiten Corona-Welle in der Schweiz wie wirksam?
Nicht-pharmazeutische Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, wie etwa Betriebsschliessungen, sind mit hohen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten verbunden. Im Auftrag des SECO hat Swiss Economics in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Mark Schelker (Universität Fribourg) die Wirkung einzelner nicht-pharmazeutischer Massnahmen auf den Pandemieverlauf, gemessen an der Anzahl Hospitalisierungen, in der Schweiz empirisch untersucht (zur Studie).
Für die Beschränkung und Schliessung von Restaurants und Bars sowie das Verbot von Grossveranstaltungen finden wir einen robusten negativen – d.h. reduzierenden – Effekt auf die Hospitalisierungsrate. Für weitere Massnahmen können aufgrund der empirischen Ausgangslage keine Aussagen zur Wirksamkeit gemacht werden. Daraus darf allerdings nicht geschlossen werden, dass diese Massnahmen keine Wirkung hatten.
Medienabdeckung z.B. NZZ, Watson (DE, FR), 10vor10, SRF (DE, FR).

Wie wird gegenwärtig die Netzanschlussbeurteilung von Verteilernetzbetreibern (VNB) durchgeführt? Gibt es Harmonisierungsbedarf?
Kurzbericht im Auftrag der E-Control (ausführlicher Bericht nicht publiziert).
Autoren: Urs Trinkner, Matteo Mattmann, Niklas Wehbring, Markus Stroot, Marian Meyer, Andreas Ulbig

Wie kann ein Schweizer Innovationsfonds ausgestaltet werden?
Im Auftrag des SECO hat Swiss Economics mit der Universität St.Gallen eine Studie zur Erarbeitung der Grundlagen eines Schweizer Innovationsfonds erstellt. Ziel eines solchen Innovationsfonds ist die Stärkung des schweizerischen Finanzierungs-Ökosystems von Start-ups während der Wachstumsphase.
Im Vordergrund stand dabei die Identifikation internationaler Best-Practices und die Bewertung möglicher Governance-Optionen eines schweizerischen Innovationsfonds. Vier idealtypische Modelle eines Innovationsfonds für die Schweiz wurden hergeleitet: Anstalt, Spezialgesetzliche AG, Mandat und EIF. Alle vier Modelle gehen mit Vor- und Nachteilen einher. Je nach politischen Präferenzen können diese unterschiedlich bewertet werden. Die Wahl eines Modells sollte daher mit einer Zieldefinition eines Schweizer Innovationsfonds beginnen («Form follows Function»).
Der Bundesrat hat am 22. Juni 2022 einen Richtungsentscheid zugunsten eines Schweizer Innovationsfonds getroffen (zur Medienmitteilung).
Autoren: Urs Trinkner, Matteo Mattmann, Matthias Finger, Lukas Bruhin, Dietmar Grichnik, Michael Greger

Studie im Auftrag des Verbands für elektronischen Zahlungsverkehr
Die Kosten des Schweizer Einzelhandels für die Abwicklung von Kartenzahlungen nehmen stetig zu. Zum einen ist dies der generellen Ausweitung von Zahlkarten als Zahlungsmittel und dem damit verbundenen Aufwandswachstum für Kommissionen zuzuschreiben. Zum anderen ist insbesondere die zunehmende Substitution der Maestro Karte durch die neue Generation von Debitkarten (Debit Mastercard, Visa Debit und V Pay) mit erheblichen Kosten für die Händler verbunden: Fallen bei Transaktionen mit der Maestro Karte keine Interchange Fees (ICF) an, dürfen gemäss Praxis der Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) für die neuen Debitkarten
während der Einführungsphase von fünf Jahren bzw. bis zum Erreichen eines Marktanteils von 15 Prozent Interchange Fees verrechnet werden.
Mit dem bevorstehenden Auslaufen der Einführungsphase entsteht in absehbarer Zeit eine Regulierungslücke im Bereich der Interchange Fees von Debitkarten. Aus diesem Anlass beauftragte der Verband elektronischer Zahlungsverkehr (VEZ) Swiss Economics, den regulatorischen Handlungsbedarf im Bereich der Interchange Fees aufzuzeigen und tragfähige Lösungen für die
Zukunft zu erarbeiten. Dabei soll nicht nur die neue Generation von Debitkarten thematisiert, sondern – im Sinne einer ausgewogenen Regulierung – sämtliche als 4-Parteien-Systeme organisierten Card Schemes adressiert werden.
Autoren: Samuel Rutz, Tobias Binz, Eva Zuberbühler, Larissa Jenal

Was waren die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie für Schweizer Allgemeinspitäler im Jahr 2020? Welche Rolle spielte das Verbot des Bundesrates von nicht-dringlichen Eingriffen vom 16. März bis 27. April 2020?
Grobanalysen von Finanzkennzahlen deuten auf Umsatzerhöhungen von rund CHF 100 Millionen und Kostenerhöhungen von rund CHF 700 Millionen hin. Insgesamt reduzierte die Corona-Pandemie die Gewinne der Schweizer Allgemeinspitäler im Jahr 2020 um rund CHF 600 Millionen. Die Gewinnrückgänge können jedoch nicht allein auf das bundesrätliche Behandlungsverbot zurückgeführt werden. Zwar kann während des Zeitraums des Verbots ein starker Rückgang der Behandlungen festgestellt werden. Dieser wurde jedoch zu bedeutenden Teilen in den Folgemonaten aufgeholt. Ausserdem wäre es aufgrund von Verhaltensanpassungen seitens Patienten und Spitälern auch ohne Verbot zu einem substanziellen Rückgang der Fallzahlen gekommen. Zur Studie...
Autoren: Tobias Binz, Urs Trinkner, Andreas Haller, Eric Kammerlander

Regulierungsfolgenabschätzung für das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Die Grundidee einer Zielvorgabe ist es, den Akteuren im Gesundheitswesen Kostenverantwortung zu übertragen. Wenn Mehrerträge nicht mehr einfach durch Mengenausweitungen generiert werden können, müssen Effizienzreserven ausgeschöpft werden. Unerwünschte Folgen (beispielsweise eine Reduktion in der Behandlungsqualität) sollen durch die Ausgestaltung der Zielvorgabe und ein Monitoring der Kosten- und Qualitätsentwicklung verhindert werden.
Der Bundesrat hat am 10. November 2021 eine Zielvorgabe für die Kostenentwicklung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) als indirekten Gegenvorschlag zur eidgenössischen Volksinitiative "Für tiefere Prämien - Kostenbremse im Gesundheitswesen" verabschiedet. Im Rahmen einer RFA hat Swiss Economics die Auswirkungen einer solchen Zielvorgabe auf gesundheitliche Akteure und die Kosten des Gesundheitssystems im Rahmen einer Studie untersucht.
Autoren: Samuel Rutz, Matteo Mattmann, Melanie Häner, Tilman Slembeck

Regulierungsfolgenabschätzung für das Bundesamt für Energie (BFE)
Die Vorlage der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (UREK-N) zur parlamentarischen Initiative Badran will die strategische Energieinfrastruktur der Lex Koller unterstellen. Swiss Economics wurde damit beauftragt, hierzu eine Regulierungsfolgenabschätzung durchzuführen.
Autoren: Urs Trinkner, Samuel Rutz, Melanie Häner, Matteo Mattmann, Larissa Jenal

Metastudie für das Tiefbauamt Zürich (TAZ)
Die Metastudie untersucht folgende Fragen: Welche Auswirkungen bringen Verkehrsberuhigungen und die Aufwertung der Strassenräume in Innenstädten mit sich? Was für eine Rolle spielen Parkplätze hierbei?
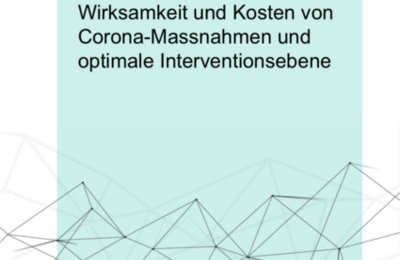
Studie zur Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Massnahmen zur Pandemiebekämpfung
Swiss Economics hat erneut die Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Massnahmen («Non-Pharmaceutical Interventions» oder NPI) zur Eindämmung des Coronavirus untersucht. Dabei handelt es sich um ein Update der im Juni 2020 im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) erstellten Meta-Analyse zu diesem Thema. Zusätzlich zur Frage der Wirksamkeit von NPI wird in der Studie auch die Literatur zu den Kosten einzelner Massnahmen evaluiert und die Erkenntnisse zu Faktoren wie dem Wetter und der Akzeptanz von NPI in der Bevölkerung diskutiert. Im Zuge der Pandemiebekämpfung kam in der Schweiz zudem auch verstärkt die Frage nach der optimalen Interventionsebene auf. Dieser Frage ist ein weiterer Teil der Studie gewidmet.
Autoren: Samuel Rutz, Matteo Mattmann, Michael Funk und David Jeandupeux

Besteht Anpassungsbedarf bei der Bestimmungsmethodik des WACC für Schweizer Stromnetzbetreiber im Zuge des Tiefzinsumfelds?
Netzbetreiber im schweizerischen Elektrizitätsmarkt werden über kostenregulierte Netznutzungsentgelte vergütet. Die Stromversorgungsverordnung gibt vor, dass ein durchschnittlicher Kapitalkostensatz (Weighted Average Cost of Capital, WACC) auf die Vermögenswerte der für den Betrieb notwendigen Netzbetreiber anzuwenden ist. Im Rahmen dieses Projektes analysiert Swiss Economics die gegenwärtige Methodik zur Berechnung des WACC und erstellt ein Gutachten, das beschreibt, wie die Berechnungen des WACC an aktuelle Marktbegebenheiten und Marktentwicklungen angepasst werden können. Zur Studie...
Autoren: Tobias Binz, Urs Trinkner, Matteo Mattmann, Felix Wüthrich

Grundlagenstudie für den liechtensteinischen Think Tank "Zukunft.li"
"Service public: Weniger Staat - mehr privat" - so lautet der Titel der neusten Publikation des liechtensteinischen Think Tanks "Zukunft.li". Swiss Economics hat die wissenschaftlichen Grundlagen für diese Publikation erarbeitet. Sie liefert in einem ersten Teil die theoretsichen Grundlagen zu Service public, beschreibt Organisations- und Finanzierungsformen und geht auf die Besonderheiten eines Kleinstaates ein. Im zweiten Teil werden die Sektoren Post, Telekommunikation, Gas, Elektrizität und öffentlicher Verkehr einzeln beleuchtet. Zu jedem Sektor haben werden drei Entwicklungsszenarien entworfen, die Vor- und Nachteile abgewogen und ein entsprechendes Fazit gezogen.
Autoren: Samuel Rutz, Urs Trinkner, Michael Funk und Melanie Häner
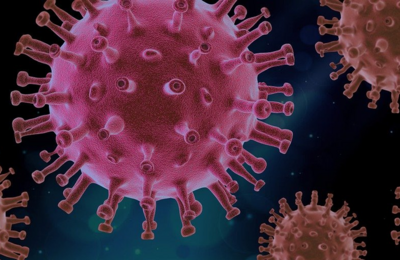
Grundlagen für die Wirtschaftspolitik, Nr. 15, Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Swiss Economics hat eine Meta-Analyse zur Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erstellt.
Nachdem während rund zwei Monaten Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft waren, erfolgten ab dem 27. April erste Lockerungsschritte. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass es in Folge dieser Lockerungsschritte zu einem Wiederanstieg der Infektionsrate oder gar einer «Zweiten Welle» von Ansteckungen kommt. Swiss Economics wurde vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) beauftragt, auf Basis einer Meta-Analyse evidenzbasierte Aussagen zur Wirksamkeit verschiedener Corona-Massnahmen zu treffen, resp. zu beurteilen, welche Massnahmen bei einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen am angebrachtesten wären.
Autoren: Samuel Rutz, Matteo Mattmann, Ann-Kathrin Crede, Michael Funk, Anja Siffert und Melanie Häner

Forschungsprojekt auf Antrag der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI)
Im Rahmen des Forschungsprojekts werden die Wechselwirkungen zwischen alltäglicher und nicht-alltäglicher Mobilität sowie zwischen Kurz- und Langstreckenmobilität genauer untersucht.
Primär geht es um die folgenden Fragestellungen:
- Verschiebungen im Zeitablauf zwischen Alltags- und Nicht-Alltagsmobilität und zwi-schen Kurzstrecken- und Langstreckenmobilität;
- Anteile an der Gesamtmobilität von verschiedenen Personengruppen mit unterschiedli-chen Distanzprofilen in der Alltags- und der Nicht-Alltagsmobilität;
- Merkmale der Person, ihrer Mobilitätswerkzeuge und ihres Umfeldes (z. B. Wohnort, Verkehrsangebot oder wirtschaftliche Entwicklung) mit einem signifikanten Zusammen-hang mit Kenngrössen der alltäglichen und nicht-alltäglichen Mobilität;
- Individuelle Veränderungen (z. B. Wechsel des Arbeitsorts, Umzüge, Familienstand o-der Einstellungen) mit einem signifikanten Zusammenhang mit Kenngrössen der alltäg-lichen und nicht-alltäglichen Mobilität;
- Verkehrliche Bedeutung sowie Muster in der Alltagsmobilität und der nicht-alltäglichen Mobilität der verschiedenen Formen des multilokalen Wohnens.

Gutachten im Auftrag der Autorité de régulation des transports.
Die Autorité de régulation des transports (ART) bestimmt das angemessene Niveau der Vergeltung der Eigenkapitalkosten, auf das Flughäfen unter ihrer Aufsicht Anspruch haben. Das französische Transportgesetz sieht vor, dass das Capital Asset Pricing Model (CAPM) verwendet wird, um die Eigenkapitalkosten der Flughäfen zu schätzen. Ein wesentlicher Bestandteil des CAPM ist der Beta-Faktor, der das systematische Risiko des Flughafens misst (d. h. das nicht-diversifizierbare Risiko). risk).
Wir bewerten die Faktoren, die Unterschiede im Beta-Risiko von Flughäfen beeinflussen, und verwenden dabei einen Rahmen, der verschiedene Grade systematischen Risikos mit einer mikroökonomischen Analyse verknüpft, wie sich Nachfrageschwankungen in Gewinnveränderungen übersetzen. Wir finden die folgenden relevanten Faktoren:
- Faktoren, die mit dem regulatorischen Regime zusammenhängen, unter dem ein Flughafen operiert: Wir stellen fest, dass das Verkehrsrisiko, das sich aus der Preisobergrenzenrigidität ergibt, eine Hauptrolle bei der Erklärung der Unterschiede im Beta-Risiko spielt.
- Faktoren, die mit der Nachfragestruktur eines Flughafens zusammenhängen: Wir stellen fest, dass Unterschiede in der Verkehrsmischung das Beta-Risiko der Flughäfen beeinflussen. Insbesondere finden wir, dass das Beta-Risiko eines Flughafens mit dem Anteil des Verkehrs von Low-Cost-Carriern zunimmt. Außerdem stellen wir fest, dass unter bestimmten Bedingungen Wettbewerb das Beta-Risiko der Flughäfen verringert.
- Faktoren, die mit der Angebotsstruktur eines Flughafens zusammenhängen: Wir stellen fest, dass Kapazitätsengpässe das systematische Risiko, dem ein Flughafen ausgesetzt ist, verringern. Zudem finden wir, dass Flughäfen mit einem höheren Grad an Kostenfixität stärker systematischem Risiko ausgesetzt sind.
Autoren: Urs Trinkner, Tobias Binz, Alec Rungger

Gutachten im Auftrag der Autorité de régulation des transports.
Die Autorité de régulation des transports (ART) bestimmt das angemessene Niveau der Vergeltung der Eigenkapitalkosten, auf das Flughäfen unter ihrer Aufsicht Anspruch haben. Das französische Transportgesetz sieht vor, dass das Capital Asset Pricing Model (CAPM) verwendet wird, um die Eigenkapitalkosten der Flughäfen zu schätzen. Ein wesentlicher Bestandteil des CAPM ist der Beta-Faktor, der das systematische Risiko des Flughafens misst (d. h. das nicht-diversifizierbare Risiko).
Swiss Economics (2020) identifiziert Gruppen von Vergleichsflughäfen, die zur Bestimmung des geeigneten Beta-Werts für jeden der Flughäfen unter der Aufsicht der ART herangezogen werden können. In diesem Bericht präsentieren wir unsere Schätzungen der Betas der Vergleichsflughäfen und beschreiben unsere Methodik zur Schätzung dieser Werte.
Wir nutzen Daten aus den tatsächlichen Börsenkursen und regulatorische Präzedenzfälle, um die Betas der Vergleichsflughäfen zu ermitteln.
Für die Schätzung der empirischen Asset-Betas verwenden wir Aktienkursdaten von Fraport (Frankfurt), Aéroports de Paris (Gruppe), Kopenhagen, AENA Aeropuertos und dem Flughafen Zürich. Wir stützen uns auf regulatorische Präzedenzfälle für den Flughafen Amsterdam Schiphol, Aeroporti di Roma, den Flughafen Dublin, den Flughafen London Gatwick und den Flughafen London Heathrow.
Autoren: Urs Trinkner, Tobias Binz, Matteo Mattmann

Gutachten im Auftrag der Finanzdirektion des Kantons Bern.
Im Rahmen einer Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) untersuchen wir die volkswirtschaftlichen Auswirkungen möglicher Strategievarianten für die Bedag Informatik AG. Dabei analysieren wir insbesondere die Auswirkungen auf die
einzelnen Stakeholder, auf die Gesamtwirtschaft sowie auf den Vollzugsaufwand.
Autoren: Rutz Samuel, Mattmann Matteo, Häner Melanie

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur
Für die Frage der sachgemässen Durchführung der Dominanzanlayse bei der DEA (Data Envelopment Analysis) auf der Grundlage der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) Im Rahmen des Effizienzvergleichs der Fernleitungsnetzbetreiber hat Swiss Economics ein Expertengutachten zuhanden der Bundesnetzagentur verfasst. Insbesondere wurde die Frage beantwortet, ob der bislang durchgeführte F-Test im Vergleich zu einem Bootstrapping, wie es von einem Netzbetreiber vorgeschlagen wurde, weiterhin vorzuziehen sei.

Studie zur Bedeutung des Klimawandels für Infrastrukturen in der Schweiz im Auftrag des UVEK
Im Rahmen eines Literaturüberblicks werden Studien aus dem In- und Ausland ab dem Jahr 2007 ausgewertet. Die zusätzlichen Schäden entstehen durch den schleichenden Klimawandel und Extremereignisse. Neben dem Transport- und dem Energiesektor sind auch die Wasserversorgung, Industrieinfrastrukturen, soziale Infrastrukturen und der Tourismus betroffen. Obwohl der Klimawandel insgesamt mehr Schaden als Nutzen bringt, hat er auch positive Auswirkungen. Zum Beispiel kommt es zu weniger kältebedingten Schäden an Strassen und Schienen und die Ausgaben für Heizenergie sinken. Mit steigenden Temperaturen nimmt auch die relative Attraktivität der Schweiz als Sommer-Tourismusdestination zu. Sämtliche verfügbaren Quantifizierungen der Auswirkungen des Klimawandels sind allerdings noch mit grossen Unsicherheiten behaftet.
Autoren: Christian Jaag, Nina Schnyder

Gutachten im Auftrag der Commission for Aviation Regulation
Unser Bericht zeigt, dass sich die Finanzmärkte derzeit in außergewöhnlichen Zeiten befinden. Die realen Renditen von Staatsanleihen sind in den letzten Jahren auf ein historisch niedriges Niveau gefallen, was darauf hindeutet, dass die real erwartete Rendite von risikolosen Vermögenswerten derzeit negativ ist. Traditionelle Ansätze zur Schätzung der Kapitalkosten könnten die Besonderheiten dieses neuen Marktumfelds möglicherweise nicht ausreichend erfassen. Daher haben wir untersucht, ob das kürzliche Ende der quantitativen Lockerung der EZB wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf den Markt haben wird, und analysiert, ob die Finanzmärkte erwarten, dass die Anleiherenditen in naher Zukunft wieder steigen werden. Außerdem haben wir Beweise in Betracht gezogen, dass die Erwartungen an Aktienrenditen im Laufe der Zeit stabiler sein könnten als die zugrunde liegenden Risikoaufschläge, was darauf hindeutet, dass ein sogenannter Total Market Return-Ansatz dem traditionellen Equity Risk Premium-Ansatz zur Schätzung der Eigenkapitalkosten vorgezogen werden könnte.
Autoren: Christian Jaag, Tobias Binz, Matteo Mattmann, Nina Schnyder, Urs Trinkner
Der volle Report kann von der Webseite der Kommission für Luftfahrt-Regulierung heruntergeladen werden.

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur
Swiss Economics hat zusammen mit SUMICSID und dem IAEW den Effizienzvergleich der Verteilernetzbetreiber Strom der dritten Regulierungsperiode durchgeführt. Eingehend wurde u.a. die Abbildung dezentraler Erzeugung analysiert. Der von der Bundesnetzagentur publizierte Schlussbericht umfasst alle wesentlichen methodischen Aspekte und dokumentiert die Resultate. Beim Effizienzvergleich werden rund deutsche 200 Netzbetreiber hinsichtlich ihrer Kosteneffizienz verglichen.

Gutachten im Auftrag des Flughafen Zürichs
Im November 2018 präsentierte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) seinen Vorschlag zur punktuellen Revision der Verordnung über die Flughafengebühren (FGV). Im Gutachten im Auftrag des Flughafen Zürichs untersuchen wir Sinn- und Zweckmässigkeit der Vorlage in Bezug auf die vorgeschlagene Methodik zur Bestimmung des regulatorischen Kapitalkostensatzes.

Forschungsprojekt auf Antrag der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI)
Autoren: Lutzenberger Martin, Trinkner Urs, Federspiel Esther, Frölicher Jonas, Georgi Dominik, Ulrich Susanne, Wozniak Thomas

Gutachten im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
Autoren: Urs Trinkner, Martin Lutzenberger

Gutachten im Auftrag der Bundesnetzagentur
Autoren: Urs Trinkner, Martin Lutzenberger, Andreas Haller, Per Agrell, Peter Bogetoft, Martin Ahlert, Peter Vossig

Studie für das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Swiss Economics hat im Auftrag des Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), eine Studie zu den ökonomischen Auswirkungen
eines Wechsels vom heutigen Marktbeherrschungstest in der Fusionskontrolle auf den in der EU verwendeten SIEC-Test erstellt. Abgeklärt wurde auch, ob eine allfällige Einführung des SIEC-Tests von weiteren Anpassungen - etwa im Bereich der Aufgreifkriterien oder Prüffristen - begleitet werden soll. Zur Beantwortung dieser Fragen wurde unter anderem auch mit in- und ausländischen Experten Interviews durchgeführt.
Autoren: Christian Jaag, Samuel Rutz, Noëmi Jacober

Bericht im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE) und des Verbandes der Schweizerischen Gasindustrie (VSG)
Autoren: Worm Heike, Trinkner Urs, Mollet Janick, Funk Michael, Vaterlaus Stephan, Hafner Matthias

Studie im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)
Autoren: Trinkner Urs, Thomas Geissmann, Ivo Scherrer, Kern Markus, Benedikt Pirker, Christian Nabe

Studie im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)
Die Studie untersucht den Entflechtungsbedarf für Schweizer Gasnetzbetreiber und schlägt für die Verteilnetzebene weniger starke Entflechtungsvorschriften vor als für die Transportnetzebene. Die stärkste Entflechtung wird für den Akteur vorgeschlagen, der die Marktgebietsverantwortung wahrnimmt.
Autoren: Trinkner Urs, Funk Michael

Studie im Auftrag der CEER (Council of European Energy Regulators)
Autoren: Agrell Per J., Bogetoft Peter, Trinkner Urs

Studie im Auftrag des Weltpostvereins
Swiss Economics wurde von der Universellen Postvereinigung (UPU) beauftragt, eine prospektive Studie zu den zukünftigen Aktivitäten ihres Quality of Service Fund (QSF) durchzuführen. Wir empfehlen, den Umfang des Fonds zu erweitern, ergänzende Top-Down-Elemente einzuführen, um globale und regionale Projekte vorzuschlagen, ein neues gemeinsames Konto zur Finanzierung solcher Projekte vorzusehen und ausgewogene Maßnahmen zu ergreifen, um die Verwendung der Mittel zu gewährleisten und die Messbarkeit der Projekte zu erhöhen.
Autoren: Trinkner Urs, Jaag Christian, Lutzenberger Martin

Gutachten im Auftrag der WirtschaftskammerÖsterreich (WKÖ)
Autoren: Trinkner Urs, Funk Michael

Studie für die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) und den Schweizerischen Gemeindeverband (SGV)
Autoren: Dietl Helmut, Jaag Christian, Trinkner Urs, Christian Bach, Michael Funk, Lutzenberger Martin, Jeffrey Yusof

Studie im Auftrag des Dachverbands Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV)
Im Hinblick auf die Diskussion der vollständigen Strommarktöffnung in der Schweiz stellt sich die Frage, inwieweit die Schweiz die Erfahrungen der EU nutzen kann. Die Analyse der Entwicklungen in der EU und Länderstudien für Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Schweiz zeigt, dass erstens in der EU noch kein Level Playing Field besteht, dass die vollständige Marktöffnung eine wesentliche Herausforderung darstellt, und dass wichtige Wechselwirkungen mit der Energiewende bestehen. Für den Fall der Schweiz ist davon auszugehen, dass eine vollständige Marktöffnung die Kosten der Energiestrategie ceteris paribus erhöhen wird. Vor dem Hintergrund sollte die Schweiz zuerst die Eckwerte der Energiestrategie festlegen und hierauf eine optimale Marktöffnungsstrategie für ihren Elektrizitätsmarkt ableiten.
Autoren: Trinkner Urs, Scherrer Ivo, Martin Irina

Studie im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)
In der Studie werden verschiedene Modelle des Zusammenwirkens von Strommärkten und Netzrestriktionen erarbeitet, analysiert und bewertet. Vor dem Hintergrund der künftigen Herausforderungen wird ein Ampelmodell vorgeschlagen, bei dem in Phase Gelb ein neuer Marktprozess zur Berücksichtigung von Netzrestriktionen zu Anwendung kommt.
Autoren: Nabe Christian, Trinkner Urs, Bons Marian

Studie im Auftrag der Schweizerischen Treuhandkamme
Der Nutzen der Wirtschaftsprüfung liegt in der Validierung von Unternehmensinformation. Für die Anspruchsgruppen eines Unternehmens ist Information als Grundlage für ihre Entscheidungen von zentraler Bedeutung. Information wird allerdings erst dann vorbehaltslos wertvoll und brauchbar für eine Anspruchsgruppe, wenn sie entweder durch die Anspruchsgruppe selbst er-stellt wurde, oder wenn sie durch eine unabhängige und qualifizierte Stelle nach objektiven und standardisierten Kriterien geprüft wurde. Diese Prüfung wertvoller Unternehmensinformation und die Reduktion von Defiziten leistet die Wirtschaftsprüfung. Das Vorgehen der Studie gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil werden unter Einbeziehung von Expertengesprächen konkrete Bedürfnisse sowie Defizite an Unternehmensinformation von Anspruchsgruppen erfasst und bewertet. Darauf aufbauend wird in einem zweiten Teil evaluiert, welchen Anteil an den Informationsdefiziten die Wirtschaftsprüfung abzubauen vermag. Unter Wirtschaftsprüfung wird dabei ausschliesslich die gesetzlich verankerte externe Revision verstanden. Im dritten Teil wird basierend auf etablierten Theorien aus der ökonomischen Literatur analysiert, inwiefern der Abbau von Informationsdefiziten durch die Wirtschaftsprüfung für die Gesamtwirtschaft wertvoll ist.
Autoren: Eberle Reto, Jaag Christian, Bach Christian, Martins Sonia Strube, Feger Fabian

Studie im Auftrag der Bundesnetzagentur
Für die deutschen Stromverteilernetzbetreiber war für die zweite Regulierungsperiode ein Effizienzvergleichsmodell zu wählen, welches den regulatorischen Anforderungen in Deutschland gerecht wird. Nach einer umfassenden Analyse konnte ein Effizienzvergleichsmodell gefunden werden, welches dasjenige der ersten Regulierungsperiode in eine sinnvolle Richtung weiterentwickelt. Im Wesentlichen wurde im Vergleich mit der ersten Regulierungsperiode der endogene Parameter Umspannstationen mit dem exogenen Parameter Anzahl Zählpunkte ersetzt. Dies ist wünschbar, da exogene, output-orientierte Parameter aus Sicht der Anreizregulierung endogenen, input-orientierten Parametern klar vorzuziehen sind. Das Modell berücksichtigt alle relevanten Netzebenen, wobei auch entsprechende disaggregierte Kostentreiber enthalten sind.

Studie im Auftrag der U.S. Postal Regulatory Commission
Die Lieferkosten stellen den größten Anteil der Gesamtkosten des United States Postal Service (USPS) dar. Diese Kosten machen 38 Prozent der gesamten Betriebskosten aus. Eine präzise Einschätzung, wie sich die Stückkosten für die Lieferung verhalten, ist entscheidend, um die Kosten korrekt den Produkten zuzuordnen. Dieser Bericht stellt die Anwendung eines Modells zur Schätzung der Beziehung zwischen den Kosten der Stadtzustellung und der Anzahl der Zustellpunkte, die Post empfangen, sowie dem Volumen der zuzustellenden Post vor. Dieses Modell verwendet Daten des Postdienstes, die es ermöglichen, den geografischen Standort aller Zustellpunkte, die von jeder Zustellroute bedient werden, das täglich auf der Route gelieferte Volumen und die vom Zusteller auf der Route verbrachte Zeit zu identifizieren. Das Modell simuliert jede Route und bestimmt die kürzeste lineare Entfernung, um alle Zustellpunkte zu bedienen, die Post erhalten.
Autoren: Trinkner Urs, Haller Andreas

Studie im Auftrag des Schweizerischen Gewerbeverbands
Autoren: Jaag Christian, Keuschnigg Christian, Strube Martins Sonia, Parra Moyano Jose, Scherrer Ivo

Studie im Auftrag der ÖBB
Eisenbahn-Personenverkehrsdienste mit integrierten regelmäßigen Intervallfahrplänen (IRIT) bieten den Fahrgästen einen regelmäßigen Fahrplan für die Dienste im Schienennetz. IRIT haben das Potenzial, die Qualität und Attraktivität von Eisenbahn-Personenverkehrsdiensten im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern zu steigern. Diese Studie fasst die Vorteile und Herausforderungen der Einführung von IRIT für den Eisenbahn-Personenverkehr zusammen und leitet die wichtigsten Anforderungen für eine erfolgreiche Einführung von IRIT ab.
Autoren: Finger Matthias, Kern Markus, Strube Martins Sonia, Trinkner Urs
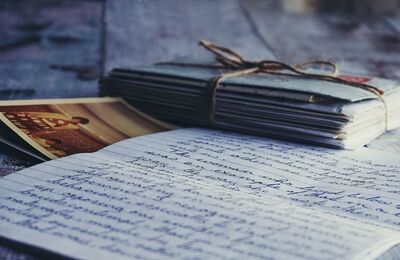
Studie im Auftrag des Deutschen Bundestages
Autoren: Trinkner Urs, Holznagel Bernd, Jaag Christian, Dietl Helmut, Haller Andreas

Studie im Auftrag der Europäischen Kommission
Dieser Bericht fasst die durchgeführten Arbeiten zur Erprobung der Verwendung von Stated-Preference-Discrete-Choice-Experimenten zur Messung der Verbraucherpräferenzen für Postdienste zusammen. Er erläutert die Bedeutung des Verständnisses und der Quantifizierung von Verbraucherprioritäten im Postsektor und stellt verschiedene Methoden zur Bewertung nicht marktgängiger Güter vor. Wir empfehlen den Einsatz von Stated-Preference-Discrete-Choice-Experimenten und testen diesen Ansatz in drei Mitgliedstaaten. Zudem präsentieren wir die Ergebnisse für diese Mitgliedstaaten sowie ein „Werkzeugkasten“ zur Anwendung dieser Methodik in weiteren Mitgliedstaaten in der Zukunft.
Autoren: Rohr Charlene, Trinkner Urs, Lawrence Alison, Hunt Priscillia, Kim Chong Woo, Potoglou Dimitris, Sheldon Rob

Studie im Auftrag des Weltpostvereins
Autoren: Trinkner Urs, Jaag Christian, Dietl Helmut, Haller Andreas, Verbeek Erwin, Fürst Oliver

Eine ökonomische Analyse der Staukosten
Autor: Jaag Christian

Studie im Auftrag von SBB Cargo
Autoren: Trinkner Urs, Jaag Christian, Dietl Helmut

Forschung bezüglich Wettbewerbsentwicklung auf Briefmärkten
Autor: Jaag Christian

Ein Wettbewerbsbeitrag von Swiss Economics über ein integrales Konzept zur Beurteilung von E-Government-Vorhaben
Autoren: Finger Matthias, Horner Samuel, Jaag Christian, Lutzenberger Martin, Trinkner Urs

Studie im Auftrag von Sunrise
Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs, Finger Matthias, Lang Markus, Lutzenberger Martin

Studie im Auftrag der Schweizerischen Post
Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs

Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft
Autoren: Jaag Christian, Keuschnigg Christian, Keuschnigg Mirela

Studie im Auftrag von Swisscom
Die Studie analysiert den regulatorischen Bedarf einer funktionalen oder strukturellen Trennung des Schweizer Incumbents Swisscom.
Autoren: Finger Matthias, Jaag Christian, Lang Markus, Lutzenberger Martin, Trinkner Urs
Recherche

Swiss Economics Working Paper, kommend in regulatorischer Ökonomie und Politik
Wir zeigen auf, dass zwischen Briefen und Paketen erhebliche Verbundvorteile insbesondere in ländlichen Gebieten bestehen. Im Zusammenhang mit der Berechnung der Nettokosten der Grundversorgung und operativen Geschäftsentscheidungen bei schrumpfenden Brief- und wachsenden Paketmengen ist es wichtig, solche Verbundvorteile zu berücksichtigen.
Authors: Ramon Gmür, Felix Gottschalk, Matthias Hafner, Urs Trinkner

Erschienen auf SSRN am 09. Oktober 2024.
Der Digital Markets Act (DMA) führt bedeutende neue Verpflichtungen für «Torwächter» (Gatekeeper) ein, also für grosse Digitalunternehmen in der Europäischen Union, gilt aber nicht für die Schweiz. Dieser Beitrag untersucht die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ausgewählter Torwächter, um zu überprüfen, ob und inwiefern die DMA-Vorgaben auch in der Schweiz eingehalten werden. Dabei zeichnen sich unterschiedliche Strategien ab: während Meta und Microsoft die Erstreckung auf die Schweiz offenbar grundsätzlich vorsehen (de facto «Brussels Effect»), gilt dies offenbar nicht für Apple und Alphabet/Google. Die selektive Nicht-Anwendung des alternativen Streitbeilegungsmechanismus durch Facebook und LinkedIn wirft weitere offene Fragen auf. Mit diesen Befunden und ihrer tentativen Bewertung leistet die Untersuchung einen Beitrag zu den Diskursen um den “Brüssel-Effekt” sowie um mögliche Reaktionen der Schweiz auf den DMA.
Autoren: Peter Georg Picht, Luka Nenadic, Octavia Barnes, Nicolas Eschenbaum, Yannick Kuster

Erschienen im Journal of Political Economy Macroeconomics, Volume 2, Number 3, September 2024
Die Deregulierung des Bankensektors auf Ebene der US-Bundesstaaten in den 1980er Jahren erleichterte die sektorale Umverteilung von Arbeitskräften nach dem Handelsschock aus China. In den 1990er Jahren waren die Bundesstaaten, die früher dereguliert hatten, finanziell besser integriert. Dies ermöglichte es den Haushalten, ihren Konsum durch Kreditaufnahme besser zu glätten. Dies stabilisierte die Nachfrage, hielt die Immobilienpreise hoch und erleichterte so die sektorale Umverteilung von Arbeitskräften aus den durch Importe betroffenen Industriesektoren hin zum Immobiliensektor.
Autoren: Lilia Habibulina, Mathias Hoffmann (Universität Zürich)

Buchbeitrag zur mikroökonomischen Fundierung unterschiedlicher Geschäftsstrategien auf Paketmärkten
Auf Paketmärkten lassen sich unterschiedliche Geschäftsstrategien beobachten. In unserem Buchbeitrag erklären wird dies anhand klassischer industrieökonomischer Modelle. Demnach ist die optimale Strategie eines etablierten Paketdienstleisters, der eine Universaldienstverpflichtung hat und mit Markteintritten konfrontiert ist, abhängig von den Eintrittskosten:
In dünn besiedelten Gebieten sind die Fixkosten hoch und eine Kapazitätsbindung möglich. Daher erfolgt der Wettbewerb über Mengen und etablierte Anbieter könnten Markteintritte grundsätzlich verhindern. Allerdings ist damit zu rechnen, dass Markteintritte durch vertikal integrierte Unternehmen mit hohen Mengen (z.B. Amazon) oder einer etablierten Vertriebsinfrastruktur (z.B. Einzelhändler) trotzdem geschehen. In beiden Fällen führt die Universaldienstverpflichtung dazu, dass der etablierte Betreiber in Kapazitäten überinvestiert und zum „Top Dog“ wird.
In dicht besiedelten Städten hingegen sind die Fixkosten niedrig und eine Kapazitätsbindung nicht glaubwürdig. Unternehmen konkurrieren daher über Preise. Da die Universaldienstverpflichtung den etablierten Postbetreiber in seiner Preissetzung beschränkt, kann er Markteintritte nicht verhindert. In diesem Fall ist unklar, ob der etablierte Postbetreiber investieren sollte, um ein „pazifistischer dicker Kater“ zu werden.
Autoren: Funk Michael, Gottschalk Felix, Zuberbühler Eva
Buchbeitrag in Service Challenges, Business Opportunities, and Regulatory Responses in the Postal Sector (2024). Parcu P., Brennan T., Glass V. (eds). Springer, Cham.
Zur Präsentation (31st Conference on Postal and Delivery Economics 2023)

Neue Veröffentlichung im ChainScience Conference Proceedings über optimale Staking-Designs.
Die Publikation untersucht die wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Auswirkungen von Proof-of-Stake (POS)-Designs und gibt einen Überblick über POS-Designs und die ihnen zugrunde liegenden ökonomischen Prinzipien in prominenten POS-Blockchains. Das Papier argumentiert, dass POS-Blockchains im Wesentlichen Plattformen sind, die drei Gruppen von Akteuren verbinden: Nutzer, Validierer und Investoren. Um den Bedürfnissen dieser Gruppen gerecht zu werden, müssen Blockchains Kompromisse zwischen Sicherheit, Benutzerakzeptanz und Protokoll-Investitionen, eingehen.
Die Autoren fokussieren auf den Sicherheitsaspekt und identifizieren zwei verschiedene Strategien: die Erhöhung der Qualität der Validatoren (statische Sicherheit) und die Erhöhung der Anzahl der Einsätze (dynamische Sicherheit). Sie stellen fest, dass die optimale Gestaltung der Einsätze von den spezifischen Zielen einer Plattform und ihrem Entwicklungsstadium abhängt. Diese Forschungsergebnisse zwingen Blockchain-Entwickler dazu, die in diesem Papier dargelegten Kompromisse bei der Entwicklung ihres Staking-Designs sorgfältig zu prüfen.
Autoren: Nicolas Oderbolz, Matthias Hafner, Beatrix Marosvölgyi

Zentrum für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht (zsis), 2/2023, S. 41-53
Die Blockchain-Technologie wurde ursprünglich entwickelt, um Bitcoin, ein Währungs- und Zahlungssystem ohne Intermediäre, zu schaffen. Heute wird sie auch in anderen Bereichen eingesetzt. In Anbetracht der steuerlichen Relevanz der Thematik gibt der vorliegende Artikel einen kurzen Überblick über die Funktionsweise verschiedener Blockchains und deren Anwendungen. Zudem werden die Einordnung von Krypto-Vermögenswerten durch Finanzmarktbehörden und die Grenzen der Technologie erläutert.
Die Publikation kann hier abgerufen werden.
Autoren: Dr. Christian Jaag und Matthias Hafner

Wolfram ChainScience Conference Proceedings [forthcoming]
Stablecoins haben in letzter Zeit erhebliche Popularität erlangt, mit einer Marktkapitalisierung von über 180 Milliarden US-Dollar. Allerdings haben jüngste Ereignisse Bedenken hinsichtlich ihrer Stabilität aufgeworfen. In diesem Papier klassifizieren wir Stablecoins in vier Typen, basierend auf der Quelle und Verwaltung der Sicherheiten, und untersuchen die Stabilität jedes Typs unter verschiedenen Bedingungen. Wir heben die potenziellen Instabilitäten und zugrunde liegenden Abwägungen jedes Typs mithilfe von agentenbasierten Simulationen hervor. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung einer sorgfältigen Bewertung der Herkunft der Sicherheiten eines Stablecoins und seines Sicherheitenmanagementmechanismus, um Stabilität zu gewährleisten und Risiken zu minimieren. Ein vertieftes Verständnis von Stablecoins sollte sowohl für Regulierungsbehörden, politische Entscheidungsträger als auch Investoren von Bedeutung sein.
Die Präsentation kann hier abgerufen werden.
Autoren: Matthias Hafner, Marco Henriques Pereira, Helmut Dietl, and Juan Beccuti

Buchbeitrag in Postal Strategies (2023). Parcu P., Brennan T., Glass V. (eds). Springer, Cham.
Die Nettokosten ergeben sich als Gewinndifferenz des Grundversorgungsdienstleisters mit und ohne Grundversorgung und entsprechen dem benötigten Abgeltungsbeitrag in einem geöffneten Markt. Im Buchbeitrag beleuchten wir, dass eine solche Abgeltung die Anreize der Grundversorgungserbringerin für Kosteneffizienz und Wachstum nicht einschränkt.
Autoren: Gottschalk Felix, Trinkner Urs, Zuberbühler Eva

The Journal of The British Blockchain Association, 6(1)
Dezentralisierte Finanzierungsplattformen (DeFi) können einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein, das auftritt, wenn Benutzer ihre Vermögenswerte nicht abheben können. Forscher und Praktiker haben festgestellt, dass die Konzentration von Einlagen in einer kleinen Gruppe von Nutzern einer der Haupttreiber des Liquiditätsrisikos ist. Typischerweise erleben Kreditplattformen zu Beginn ihrer Tätigkeit eine hohe Konzentration. Infolgedessen sehen sie sich einem erheblichen Liquiditätsrisiko gegenüber, das bisher nicht untersucht wurde. Dieser Artikel schließt diese Lücke, indem er das Liquiditätsrisiko aus der Perspektive einer neuen Kreditplattform untersucht und den Anwendungsfall von Folks Finance beschreibt. Zunächst beschreiben wir das Liquiditätsrisiko, dem das Kreditprotokoll aus der Sicht der Plattformökonomie ausgesetzt ist. Zweitens bewerten wir theoretisch die Wirksamkeit verschiedener Messmethoden für das Liquiditätsrisiko. Drittens untersuchen wir, wie ein Belohnungsmechanismus das Liquiditätsrisiko verringern kann. Wir zeigen, dass das Liquiditätsrisiko für eine neue Kreditplattform ausgeprägter ist als für ein etabliertes Protokoll. Darüber hinaus stellen wir fest, dass der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) andere Messmethoden für das Liquiditätsrisiko übertrifft. Schließlich zeigen wir, dass, wenn die Belohnungen ausreichend, aber nicht zu hoch sind, ein Programm, das Einleger dazu anregt, ihre Vermögenswerte zu sperren, das Liquiditätsrisiko verringern und den Liquiditätsaufbau fördern kann. Aus der Fallstudie lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ziehen: Erstens sollten neue Kreditplattformen besonders vorsichtig im Umgang mit Liquiditätsrisiken sein. Zweitens sollten Kreditprotokolle den HHI anstelle anderer Konzentrationsmessungen verwenden, wenn sie ihre Parameter kalibrieren. Drittens können Belohnungen verwendet werden, um Liquidität zu fördern und die Liquiditätsbereitschaft zu incentivieren, sollten jedoch nicht übermäßig eingesetzt werden.
Die Publikation kann hier abgerufen werden.
Autoren: Nicolas Greber, Romain de Luze, Matthias Hafner, Juan Becutti (joint work with Folks Finance)

Buchbeitrag in The Postal and Delivery Contribution in Hard Times (2023). Parcu P., Brennan T., Glass V. (eds). Springer, Cham.
Im Buchbeitrag beleuchten wir "Retention Ratios". Diese geben an, wie gross der Anteil der Menge einer Filiale ist, der bei einer Schliessung derselben in anderen eigenen Filialen aufgefangen wird.
Autoren: Matthias Hafner, Lory Iunius, Urs Trinkner

Beitrag in der Schweizerischen Zeitschrift für Kartellrecht
Spätestens seit der Corona-Pandemie erleben Subventionen eine globale Renaissance. Dies, obwohl seit langem bekannt ist, dass Subventionen mit Marktverzerrungen und allokativen Ineffizienzen einhergehen. Während die Vergabe von Subventionen in der Schweiz auf Bundesebene wenigstens teilweise transparent ist, herrscht auf Kantons- und Gemeindeebene ein undurchschaubares Dickicht. Subventionen können zwar kartellrechtlich relevant sein, in der Breite lassen sich aber mit dem Wettbewerbsrecht deren negativen wettbewerblichen Effekte kaum adressieren. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Schweiz ein verbindliches Beihilferecht braucht.
Autor: Samuel Rutz

Buchbeitrag in "The Economics of the Postal and Delivery Sector" (2022). Parcu P., Brennan T., Glass V. (eds). Springer, Cham.
Die Nettokosten ergeben sich als Gewinndifferenz des Grundversorgungsdienstleisters mit und ohne Grundversorgung. Im Buchbeitrag beleuchten wir die wesentlichen theoretische Konzepte vor dem Hintergrund von Rückgängen bei Briefen und Transaktionen in Poststellen. Wir zeigen zudem auf, welche Grundversorgungsdimensionen in der Schweiz perspektivisch bis ins Jahr 2030 wie teuer sind.
Autoren: Gottschalk Felix, Hafner Matthias, Trinkner Urs

Beitrag im Jusletter vom 11. Oktober 2021
Preisabreden und Marktabschottungen sind zwei Kernbereiche des Schweizer Kartellrechts, in denen über die Jahre wichtige Entscheide ergangen sind und hohe Bussen ausgesprochen wurden. Es sind aber auch Bereiche, in denen die Interventionen immer mehr politisch motiviert sind, etwa im Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz. Samuel Rutz und Monique Sturny unternehmen entlang der Zeitachse eine kurze Reise von den Anfängen der Kartelle in der Schweiz hin zum aktuellen Stand des Kartellgesetzes. Zum Schluss folgen eine Würdigung und ein Ausblick auf die sich abzeichnenden Entwicklungen.

Competition and Regulation in Network Industries. 2020;21(3):297-312
Der Artikel präsentiert einen grafischen Rahmen, basierend auf Subrahmanyam und Thomadakis (1980), der es ermöglicht, den Einfluss von Unternehmens- und Markteigenschaften auf das systematische Risiko, das mit der Kapitalrendite verbunden ist, also das Beta-Risiko, für Versorgungsunternehmen unter Preisregulierung zu untersuchen. Innerhalb dieses Rahmens wird das Beta-Risiko durch die Größe der Gewinnschwankungen, die durch Nachfrageschocks verursacht werden, bestimmt.
Der Rahmen wird dann auf die Merkmale von Flughafenunternehmen und die Eigenschaften des Flughafenmarktes angewendet. Es wird festgestellt, dass die Häufigkeit von Preisregulierungsanpassungen, das Niveau des operativen Hebels, das Ausmaß der Kapazitätsengpässe und der Grad der Marktmacht alle einen eindeutigen Einfluss auf das Niveau des Beta-Risikos haben. Der Umfang des regulatorischen Rahmens und die Art der Verkehrsstruktur können ebenfalls das Beta-Risiko beeinflussen; die Größe und Richtung ihres Einflusses hängen jedoch von den spezifischen Umständen des jeweiligen Falls ab.
Der Artikel kann politischen Entscheidungsträgern helfen, wirtschaftlich fundierte Empfehlungen darüber zu formulieren, wie die regulatorische Kapitalrendite für Flughafenbetreiber festgelegt werden sollte. Insbesondere legen meine Ergebnisse Kriterien nahe, die verwendet werden können, um geeignete Vergleichsunternehmen mit vergleichbarem systematischen Risiko auszuwählen.

Buchbeitrag in "The Changing Postal Environment. Topics in Regulatory Economics and Policy." Parcu P., Brennan T., Glass V. (eds). Springer, Cham.
Universaldienstleister sind vermehrt in Geschäftsfeldern ausserhalb der Grundversorgung tätig. Aus wettbewerblicher Sicht stellt sich die Frage der Quersubventionierung. Im Buchbeitrag analysieren wir die wettbewerblichen und volkswirtschaftlichen Eigenschaften des Nettokostenausgleiches (NKA), der in der Schweiz im Postsektor seit 2013 Anwendung findet. Im Vergleich zum üblichen Standard der aktivitätsbasierten Vollkostenverrechnung (ABC) können mit dem NKA die relevanten wettbewerbsökonomischen Bedenken ausgeräumt und gleichzeitig die Wohlfahrtseigenschaften verbessert werden.
Autoren: Haller Andreas, Jaag Christian, Trinkner Urs

Concurrences N°4-2019, pp. 50-58.
Wir führen den Leser in drei stilisierte Szenarien ein, die von Praktikern häufig genannt werden, wenn sie nach dem Anteil der Kartellüberhöhung gefragt werden, der von direkten zu indirekten Lieferanten weitergegeben wurde. Wir zeigen, wie empfindlich solche Prognosen in Bezug auf viele der zugrunde liegenden Annahmen sind. Bereits geringe Abweichungen von den Standardannahmen können die Prognosen vollständig umkehren. Wir kommen zu dem Schluss, dass eine zuverlässige Schätzung der Weitergaberechnung immer auf tatsächlichen Beweisen basieren muss – entweder um theoretische Modelle zu ergänzen oder als Input für evidenzbasierte Modelle zu dienen.
Autoren:
Tobias Binz, Swiss Economics
Pierre Fleckinger, MINES ParisTech, Paris School of Economics
Christian Jaag, Swiss Economics
Constance Monnier, Université Paris, Panthéon Sorbonne

Buchbeitrag zur kohärenten institutionellen Ausgestaltung im Bahnmarkt.
Seit der Bahnreform 1999 werden Bahndienstleistungen von der öffentlichen Hand nach dem Gewährleistungsmodell bei den Bahnen bestellt und abgegolten. Ursprünglich ohne Regulator RailCom, aber mit einer schlanken Schiedskommission SKE zur Streitbeilegung im Bereich Netzzugang gestartet, sind die beim BAV allozierten Aufgaben umfangreich. Im vorliegenden Artikel gehen wir der Frage nach, wie die bestehende institutionelle Ausgestaltung des mit der Bahnreform eingeführten Gewährleistungsmodells weiterentwickelt werden kann. Basierend auf dem Konzept der Gewaltenteilung und der Principal-Agent Theorie leiten wir eine neue Aufgabenteilung ab, welche die Aufgaben im Bereich Versorgung/Verlagerung konsequent beim BAV verortet, während die Aufgaben im Bereich Markt bei der RailCom angesiedelt werden. Die gestärkte RailCom erlaubt es, die Trassenvergabestelle aufzulösen und deren Aufgaben den Infrastrukturbetreibern zuzuweisen. Die durch das öffentliche Eigentum anfallenden Eigeneraufgaben sehen wir konsequent bei einem anderen Departement als dem UVEK angesiedelt.
Autoren: Urs Trinkner, Martin Lutzenberger

Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (sic!), 5/2019, S. 304-306
Das Bundesgericht hat die Anwendung des Kartellverbots zuletzt deutlich verschärft: Preis-, Mengen und Gebietsabsprachen sind unabhängig von deren Wettbewerbswirkung de facto verboten. Schon früher hat das Bundesgericht das Wettbewerbsrecht mit ähnlich weitreichenden Entscheiden geprägt. Heute können Fusionen kaum noch untersagt werden, und unangemessene Preise werden nicht mehr sanktioniert. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung gefährdet die Kohärenz des Kartellgesetzes: Während im Bereich der Fusionen und unangemessener Preise ein «Laissez-faire»-Ansatz praktiziert wird, wird bei den Abreden eine äusserst interventionistische Politik verfolgt. Den Unternehmen werden dadurch starke Anreize gesetzt, das harte Kartellverbot durch Fusionen zu umgehen.

Zeitschrift für internationales Steuerrecht, p. 66-83
Verlangt die Digitalisierung neue Regeln für die internationale Besteuerung von Unternehmen? Die OECD und die EU möchten das internationale Steuerrecht zu Gunsten der Absatzstaaten anpassen.
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Europarecht hat Christian Jaag zusammen mit Luzius Cavelti einen Leitartikel zum Thema «Die Bedeutung der Digitalisierung für das internationale Unternehmenssteuerrecht» publiziert.
Autoren: Luzius Cavelti, Christian Jaag

Journal of Competition Law & Economics, Volume 14 (2), pp 292-310
The «more economic approach» was introduced to antitrust to achieve a more effect-based and theoretically grounded enforcement. However, related to predatory pricing it resulted in systematic over- and under-enforcement: Economic theory does not require dominance for predation to be a rational (and harmful) strategy, although an ex ante dominant firm would often refrain from predation. Hence, within the current legal framework which requires dominance for antitrust to apply, a more effect-based and theoretically grounded antitrust enforcement cannot pursue harmful predation. Therefore, we suggest separating predatory pricing from exclusionary abuse of a dominant firm, both legally and analytically. Instead, predatory pricing should be analyzed along the same logic as a merger. In particular, we argue that three elements from merger control should be adopted: in the absence of dominance, market share and/or turnover thresholds may serve as a de minimis rule; recoupment should be analyzed similar to the competitive effect of a merger between the predator and its prey; and a stronger efficiency defense should be established.
Autoren: Michael Funk, Christian Jaag
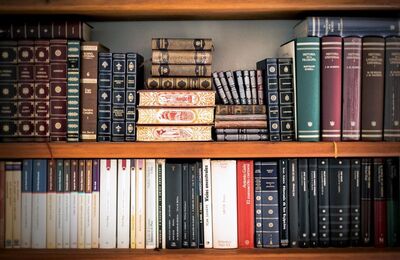
Journal of Competition Law & Economics, Volume 14 (2), pp 235-261
Diese Studie schlägt eine Methode zur Erkennung von Angebotsabsprachen vor, indem gegenseitig verstärkende Prüfmechanismen auf einen Datensatz von Ausschreibungen im Straßenbau aus der Schweiz angewendet werden, bei dem keine vorherigen Informationen über Kollusion vorlagen. Die Screening-Methode eignet sich besonders gut zur Behandlung des Problems der partiellen Kollusion, das heißt, Kollusion, die nicht alle Unternehmen und/oder alle Verträge in einem bestimmten Datensatz umfasst. Dies impliziert, dass viele der klassischen Indikatoren, die in der entsprechenden Literatur diskutiert werden, Angebotsabsprachen nicht identifizieren können. Neben der Vorstellung neuer Prüfmechanismen für Kollusion wird gezeigt, wie Benchmarks und die Kombination verschiedener Prüfmechanismen verwendet werden können, um Untergruppen von verdächtigen Verträgen und Unternehmen zu identifizieren. Die vorgestellte Screening-Methode gelingt es, eine Gruppe von verdächtigen Unternehmen zu isolieren, die die Merkmale eines lokalen Kartells zur Angebotsabsprachen mit Deckungsgeboten und einem mehr oder weniger ausgeprägten Bieterdrehungsschema aufweisen. Auf Basis dieser Erkenntnisse leitete die Wettbewerbskommission der Schweiz (COMCO) 2016 eine Untersuchung ein und sanktionierte die identifizierten verdächtigen Unternehmen wegen Angebotsabsprachen.
Autoren: Imhof David, Karagök Yavuz, Rutz Samuel

Finanz und Wirtschaft
In einem Artikel in der Finanz und Wirtschaft legt Samuel Rutz dar, dass die 2015 beschlossene Revision des Konsumkreditgesetzes ihre Ziele nicht erreicht hat.
Autor: Rutz Samuel

In: The Changing Postal and Delivery Sector. Edited by M. Crew, P.L. Parcu and T. Brennan, Springer, pp 271-28
Briefpostdienste stehen unter Druck durch das Aufkommen elektronischer Kommunikationskanäle.
Autoren: Geissmann Thomas, Jaag Christian, Maegli Martin, Trinkner Urs

In: The Future of the Postal Sector in a Digital World. Edited by M. Crew and T. Brennan, Springer, Chapter 8
Autoren: Jaag Christian, Moyano Jose Parra, Trinkner Urs

Der Schweizer Treuhänder 3/4-2015
Autoren: Eberle Reto, Jaag Christian, Bach Christian

In: Postal and Delivery Innovation in the Digital Economy. Edited by M. Crew and T. Brennan, Springer, pp. 155-168
Autoren: Robinson Matthew H., Klingenberg J.P., Haller Andreas, Trinkner Urs

In: Postal and Delivery Innovation in the Digital Economy. Edited by M. Crew and T. Brennan, Springer, pp. 301-312
Autoren: Jaag Christian, Maegli Martin
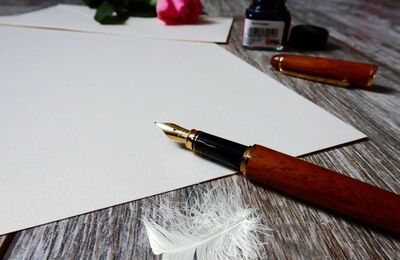
Utilities Policy 31, pp. 266-277
Diese Studie behandelt die wichtigsten Aspekte des wettbewerbs- und regulatorischen Zustands des Postsektors. Sie stellt die verschiedenen Modelle für Postwettbewerb und -regulierung in der EU und den USA sowie deren Geschichte vor und beleuchtet ihre Auswirkungen auf die Regulierung, mit einem Fokus auf universelle Dienstleistungen und Netzwerkzugang. Während Postmonopole früher die Hauptquelle der Finanzierung für universelle Serviceverpflichtungen waren, hat das Bedürfnis nach alternativen Finanzierungsquellen nach der vollständigen Liberalisierung das Interesse von Regulierungsbehörden und der Öffentlichkeit an den Kosten dieser Verpflichtungen erhöht. Parallel dazu stellen neue elektronische Kommunikationsmittel und die Bedürfnisse der Verbraucher den traditionellen Umfang der universellen Dienstleistungen infrage. Dieses Papier skizziert die wirtschaftliche Grundlage der aktuellen politischen Maßnahmen und gibt Hinweise auf zukünftige postalische Regulierungsrichtlinien, die die kommerzielle Lebensfähigkeit der Postdienstleistungen in einem wettbewerbsintensiven Zeitalter stärken und gleichzeitig ihre relevanten Merkmale für die Wirtschaft bewahren sollen.
Autor: Jaag Christian

Competition and Regulation in Network Industries, 15(1), pp. 78 - 107
Eisenbahn-Personenverkehrsdienste mit integrierten Fahrplänen in festen Intervallen (IRIT) bieten den Fahrgästen einen regelmäßigen Intervallfahrplan für die Dienste im Schienennetz. IRIT haben das Potenzial, die Qualität und Attraktivität von Eisenbahn-Personenverkehrsdiensten im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln zu steigern. Dieser Artikel fasst die Vorteile und Herausforderungen der Einführung von IRIT für den Eisenbahn-Personenverkehr zusammen und leitet die Hauptanforderungen für die erfolgreiche Einführung von IRIT ab.
Der Vergleich des regulatorischen Rahmens, der Rolle von IRIT und der Entwicklung des Personenverkehrs auf der Schiene in der Schweiz (CH), den Niederlanden (NL) und dem Vereinigten Königreich (UK) zeigt, dass in den Ländern, in denen entweder IRIT eingeführt wurde (CH) oder die hohe Häufigkeit von Zügen zwischen Städten ein System vergleichbar mit IRIT ermöglicht (NL), der Eisenbahnverkehr eine wichtigere Rolle im Modal Split spielt. Die erfolgreiche Einführung von IRIT erfordert einen langfristigen Implementierungsplan, der die notwendigen Investitionen in die Schieneninfrastruktur identifiziert und aufzeigt, welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um diese Investitionen zu tätigen. Darüber hinaus erfordert IRIT ein hohes Maß an Pünktlichkeit der Eisenbahn-Personenverkehrsdienste, die Koordination zwischen den Eisenbahnunternehmen bei der Gestaltung des Fahrplans und eine Vorrangregel für die Eisenbahn-Personenverkehrsdienste innerhalb von IRIT, wenn es auf dem Schienennetz zu Kapazitätsbeschränkungen kommt.
Autoren: Finger Matthias, Haller Andreas, Strube Martins Sonia, Trinkner Urs

In The Role Of The Postal And Delivery Sector In A Digital Age. Edited by M. Crew and T. Brennan, Edward Elgar, pp. 204-213
Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs and Uotila Topias

In: The Role Of The Postal And Delivery Sector In A Digital Age. Edited by M. Crew and T. Brennan, Edward Elgar, pp. 227-239
Autoren: Haller Andreas, Jaag Christian and Trinkner Urs

In: Studien zur Freizeit- und Tourismusforschung. Hrsg: S. Kübelböck and F. Thiele, MetaGIS-Fachbuch, pp. 155-170
Autoren: Liebrich Andreas, Lutzenberger Martin, Amstad Olivia

Review of Law and Economics 9(1), pp. 125-150
Dieser Artikel untersucht die komplementären Rollen der Preisregulierung und der Regulierung des universellen Dienstes in Netzindustrien. Er analysiert die Entschädigung für den Anbieter des universellen Dienstes (USP) durch öffentliche Finanzen und einen Fonds, in den Betreiber einzahlen. Solange der USP über Marktmacht verfügt, kann die Preisregulierung als Mittel zur Finanzierung universeller Dienstleistungen dienen. Dies bedeutet, dass Preiserhöhungen zugelassen werden, um die Nettokosten der universellen Serviceverpflichtung zu kompensieren. Dadurch wird es den Wettbewerbsanbietern oder dem allgemeinen Staatshaushalt ermöglicht, sich von der Finanzierung zu befreien, aber es führt zu verzerrten Preisen und verringertem Gesamtwohlstand aufgrund ineffizienter Markteintritte. Die Analyse zeigt, dass die aktuellen Praktiken der Kostenermittlung und Finanzierung universeller Dienstleistungen zu unbeabsichtigten Marktverzerrungen führen können. Der Artikel quantifiziert diese Effekte und zeigt, wie solche Verzerrungen vermieden werden können.
Autor: Jaag Christian
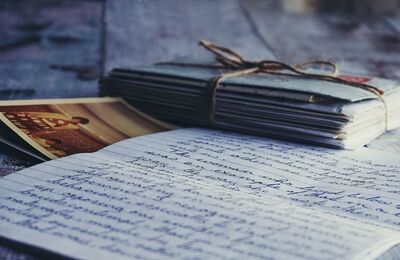
In: Reforming the Postal Sector in the Face of Electronic Competition. Edited by M. Crew and P.R. Kleindorfer, Edward Elgar, pp. 294-305
Autoren: Maegli Martin, Jaag Christian

In: Reforming the Postal Sector in the Face of Electronic Competition. Edited by M. Crew and P.R. Kleindorfer, Edward Elgar, pp. 277-293
Autoren: Haller Andreas, Jaag Christian, Trinkner Urs
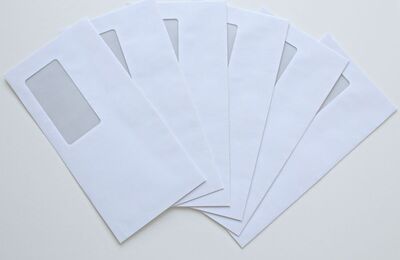
In: Reforming the Postal Sector in the Face of Electronic Competition. Edited by M. Crew and P.R. Kleindorfer, Edward Elgar, pp. 241-26
Autoren: Rohr Charlene, Trinkner Urs, Lawrence Alison, Kim Chong Woo, Potoglou Dimitris, Sheldon Rob

In: GSTF Journal on Business Review, Vol. 2, No. 2, p. 219 - 224
Das Ziel dieser Studie ist es, mehr über das Verständnis von Touristen für nachhaltigen Tourismus zu erfahren. Die empirische Umfrage mit über 6.000 Teilnehmern in acht Ländern identifiziert die relevantesten Aspekte des nachhaltigen Tourismus aus der Perspektive der Touristen. Insgesamt ist die Wahrnehmung ausgewogen über die verschiedenen Dimensionen hinweg. Darüber hinaus werden in einer Clusteranalyse fünf unterschiedliche Typen hinsichtlich des Verständnisses von nachhaltigem Tourismus identifiziert. Zudem wird ein potenzieller Marktanteil für nachhaltigen Tourismus von 22 % aller Touristen ermittelt.
Autoren: Wehrli Roger, Egli Hannes, Lutzenberger Martin, Pfister Dieter, Stettler Jürg
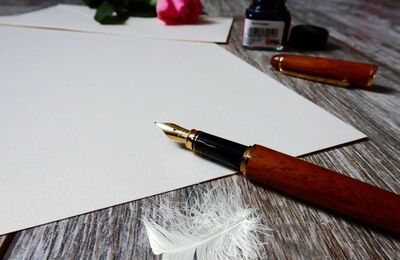
In Multi-Modal Competition And The Future Of Mail. Edited by M. Crew and P.R. Kleindorfer, Edward Elgar, pp. 236-246
Autoren: Jaag Christian, Dietl Helmut, Trinkner Urs, Fürst Oliver

Wirtschaftsdienst - Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 92(1), 4-5
Autor: Trinkner Urs

Competition and Regulation in Network Industries, 12(2), 108-129
Traditionell basieren universelle Dienstleistungen in Netzindustrien auf der Gewährung eines reservierten Bereichs für den Universaldienstanbieter. Aktuelle Liberalisierungspolitiken, die den Markteintritt von Wettbewerbern fördern, können den traditionellen Universaldienst und dessen Finanzierung gefährden. Daher besteht ein zunehmendes Interesse an der Schätzung der Kosten für die Erbringung universeller Dienstleistungen.
Im Postsektor schlägt die dritte EG-Richtlinie eine Berechnungsmethode vor, um die Nettokosten einer Universaldienstverpflichtung zu bestimmen und den Universaldienstanbieter (USP) zu entschädigen. In diesem Beitrag diskutieren wir verschiedene Ansätze zur Kostenberechnung und Finanzierung der Universaldienstverpflichtung auf Grundlage der Profitabilitätskosten und argumentieren, dass ein ganzheitlicher Ansatz notwendig ist, um die zentralen Anforderungen an Konsistenz und Robustheit zu erfüllen.
Autoren: Jaag, Christian, Trinkner Urs, John Lisle, Navin Waghe, Erik Van Der Merwe

Journal of Regulatory Economics 39(1), 89-110
Die Finanzierung des Universaldienstes basierte traditionell auf der Gewährung eines reservierten Bereichs für den Universaldienstanbieter. Zusammen mit der zunehmenden elektronischen Substitution können aktuelle Liberalisierungspolitiken, die den Markteintritt von Wettbewerbern fördern, den traditionellen Universaldienst gefährden. Daher besteht ein wachsendes Interesse an der Schätzung der Kosten für die Erbringung universeller Dienstleistungen. Die dritte EG-Postrichtlinie schlägt eine Berechnungsmethode vor, um die Nettokosten einer Universaldienstverpflichtung separat zu bestimmen und den Universaldienstanbieter (USP) zu entschädigen. Dieses Papier untersucht die Wechselwirkungen zwischen der Kostenberechnung und der Finanzierung des Universaldienstes und zeigt, dass der EG-Ansatz zu verzerrten Ergebnissen führen kann. Es quantifiziert die Effekte anhand einer Modellkalibrierung mit Schweizer Daten. Die Ergebnisse zeigen, dass eine getrennte Kosten- und Finanzierungsberechnung zu einer erheblichen Unterkompensation des USP führt, wenn ein Entschädigungsfonds existiert, in den alle Betreiber einzahlen. Der USP wird hingegen überkompensiert, wenn er von der Beitragszahlung zum Fonds befreit ist (Pay-or-Play-Mechanismus). Das Problem der Unter- oder Überkompensation kann durch eine integrierte Berechnung der Nettokosten gelöst werden, die die Wettbewerbseffekte des Finanzierungsmechanismus berücksichtigt. Ein solcher integrierter Ansatz führt zu einer fairen Entschädigung des USP.
Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs

The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy 11(1), Article 19
Autoren: Dietl, Helmut, Jaag Christian, Lang Markus, Trinkner Urs

In: Jahrbuch der Schweizerischen Verkehrswirtschaft. C. Lässer, T. Bieger and R. Maggi (Hrsg.), 2011, 97-114
Autoren: Grotrian Jobst, Jaag Christian, Trinkner Urs

In: Reinventing the Postal Sector in an Electronic Age. Edited by M. Crew and P.R. Kleindorfer, Edward Elgar, 267-280
Autoren: Dietl Helmut, Jaag Christian, Lang Markus, Lutzenberger Martin, Trinkner Urs

Journal for Competition and Regulation in Network Industries, Vol. 4, 382-397
Autoren: Maegli Martin, Jaag Christian, Koller Martin, Trinkner Urs

In: Heightening Competition in the Postal and Delivery Sector, edited by M.A. Crew and P.R. Kleindorfer. Cheltenham, UK: Edward Elgar
Ziel dieser Studie ist es, die Kostenstruktur der Postfilialen der Schweizerischen Post zu analysieren. Insbesondere soll untersucht werden, inwieweit Skaleneffekte und Verbundvorteile in Postfilialen und Franchisepostagenturen bestehen. Informationen über die optimale Größe und Produktionsstruktur dieser Einrichtungen sind für politische Entscheidungsträger von Bedeutung, da diese hypothetische Situation als Grundlage für die Berechnung von Entschädigungen bei der Erbringung des Universaldienstes dienen kann. Diese Studie führt zwei wichtige Neuerungen ein. Erstens berücksichtigt das Latent-Class-Modell Postfilialen mit unterschiedlichen, durch nicht beobachtbare Faktoren bedingten Produktionstechnologien. Zweitens beinhaltet das Kostenmodell die Standby-Zeit als Indikator für den öffentlichen Dienst, da regulierte Erreichbarkeit und vereinbarte Öffnungszeiten, die den öffentlichen Dienst verbessern, häufig zu längeren Öffnungszeiten führen als zur Bewältigung der Nachfrage erforderlich wäre. Insgesamt bestätigt diese Analyse das Vorhandensein zunehmender, aber ungenutzter Skaleneffekte und Verbundvorteile bei sinkendem Output im Postfilialnetz der Schweizerischen Post. Darüber hinaus weisen die Ergebnisse des Latent-Class-Modells auf eine nicht beobachtbare Heterogenität innerhalb der Branche hin.
Autoren: Filippini Massimo, Koller Martin, Trinkner Urs
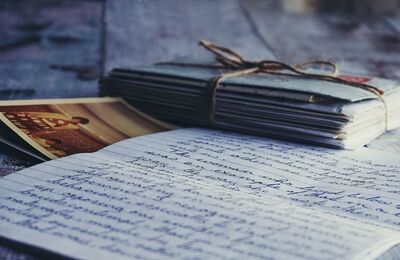
In: Heightening Competition in the Postal and Delivery Sector, edited by M.A. Crew and P.R. Kleindorfer. Cheltenham, UK: Edward Elgar
Autoren: Calzada Joan, Jaag Christian, Trinkner Urs

Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, ISBN 3838107888
Das Postmarkt ist eine der ältesten, wenn nicht die älteste Netzwerkbranche. Nach Jahrhunderten privater und öffentlicher Postmonopole strebt die EU eine vollständige Liberalisierung des Briefmarktes an, während gleichzeitig die universelle Grundversorgung gewährt bleiben soll. Basierend auf Schweizer Daten identifiziert das Buch zunächst die Haupttreiber des Briefvolumens und widmet sich besonders der „E-Substitution“, einer der größten Herausforderungen der Branche. Anschließend werden die wichtigsten Kostenmerkmale des Postmarktes analysiert. Im Kern des Buches werden die zentralen regulatorischen Marktmodelle beschrieben, modelliert und hinsichtlich ihrer Preis- und Wohlfahrtswirkungen untersucht. Der letzte Teil des Buches beleuchtet die Zwei-Seitigkeit des Postmarktes – ein entscheidender Aspekt für eine langfristig erfolgreiche Regulierung. Für den Schweizer Fall wird insbesondere die Frage erörtert, ob eine vollständige Marktöffnung des Schweizer Briefmarktes unter den aktuellen Universaldienstverpflichtungen wirtschaftlich sinnvoll ist.
Autor: Trinkner Urs

Journal of Pension Economics and Finance 8(2), 189-223
Diese Studie behandelt zwei zentrale Fragen zu den Auswirkungen der Bevölkerungsalterung auf Bildungsentscheidungen im Kontext eines umlagefinanzierten Rentensystems: Erstens analysieren wir die direkten Effekte einer alternden Bevölkerung auf individuelle Qualifikationsentscheidungen, Weiterbildung und die Produktionsstruktur. Zweitens untersuchen wir die Folgen einer verzögerten Pensionierung, die häufig als Maßnahme zur Bewältigung der wirtschaftlichen Herausforderungen einer erhöhten Lebenserwartung vorgeschlagen wird. Unsere Studie basiert auf einem dynamischen allgemeinem Gleichgewichtsmodell mit überlappenden Generationen und probabilistischer Alterung. Das Modell berücksichtigt zudem eine komplementäre Beziehung zwischen Kapital und Qualifikationen in der Produktion des Endoutputs.
Unsere Simulation zeigt, dass in einer kleinen offenen Volkswirtschaft mit fixem Zinssatz die Alterung der Bevölkerung das BIP negativ beeinflusst, da sie sich nachteilig auf die Wahl von Qualifikationen und das Arbeitsangebot auswirkt. Als mögliche Gegenmaßnahme analysieren wir die Auswirkungen einer späteren Pensionierung, die die Bildung von Humankapital fördern könnte. Allerdings führt dieser Ansatz zu einer geringeren privaten Ersparnis, sodass die Gesamtwirkung auf das BIP noch negativer ausfällt als im reinen Alterungsszenario.
Autor: Jaag Christian

Revue d'économie industrielle 127(3)
Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Liberalisierungsprozessen in Netzindustrien wird der Regulierung und damit den Regulierungsinstitutionen zugeschrieben. Regulierung soll durch die Korrektur von Marktversagen einen positiven Einfluss auf das gesellschaftliche Wohlergehen haben. Staatliche Eingriffe verursachen jedoch auch Kosten, die wir als Kosten der regulatorischen Governance bezeichnen. Diese entstehen durch negative Folgen unnötiger regulatorischer Anforderungen oder durch die Anwendung ungeeigneter Regulierungsinstrumente. Aus der Perspektive der Neuen Institutionenökonomik hängen diese Kosten von den formellen und informellen Regeln zwischen den beteiligten Akteuren, der Verteilung von Eigentumsrechten sowie den verschiedenen Prinzipal-Agent- oder allgemein vertraglichen Beziehungen ab. In diesem Artikel definieren wir einen analytischen Rahmen für die Kosten der regulatorischen Governance. Wir unterscheiden zwischen direkten und indirekten Regulierungskosten: Direkte Kosten beziehen sich auf die institutionelle Ausgestaltung des regulatorischen Rahmens und das Verhalten der Akteure, während indirekte Kosten durch Fehlanreize entstehen und letztlich zu einer ineffizienten Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen führen. Am Beispiel des Schweizer Postmarktes skizzieren wir eine mögliche Anwendung des Rahmens. Unser Ziel ist es dabei nicht, Regulierungskosten zu quantifizieren oder Regulierung grundsätzlich infrage zu stellen, sondern vielmehr ein Konzept zu entwickeln, das hilft, eine strukturierte Diskussion über regulatorische Herausforderungen in Netzindustrien zu führen.
Autoren: Mägli Martin, Jaag Christian, Finger Matthias

Journal for Competition and Regulation in Network Industries 10(4), 313-332
In den letzten Jahrzehnten haben mehrere Länder digitale Bieterverfahren zur Vergabe von Zuschüssen für universelle Dienstleistungen oder öffentliche Aufgaben in verschiedenen Sektoren eingeführt. Beispiele hierfür sind der städtische Verkehr, der Luftverkehr und die Telekommunikation. Kürzlich wurden solche Mechanismen auch in liberalisierten Postmärkten in Betracht gezogen. Die Ausschreibung von Verpflichtungen in ansonsten liberalisierten Märkten unterscheidet sich erheblich vom Versteigern einer monopolistischen Bereitstellung von Dienstleistungen oder Gütern („Wettbewerb um den Markt“), wie es z.B. bei der Vergabe von Frequenzen im Telekommunikationssektor der Fall ist. Wir erörtern die Begründung für die Einführung eines solchen regulatorischen Rahmens sowie konzeptionelle und praktische Probleme im Zusammenhang mit seiner Umsetzung. Es stellt sich heraus, dass die Gestaltung einer effizienten Ausschreibung für universelle Dienstleistungszuschüsse in liberalisierten Märkten deutlich schwieriger ist als die Ausschreibung einer Monopolfranchise. Ein erster Grund ist, dass die Kostenbewertung im ersteren Fall komplexer ist, da zukünftige Wettbewerbsmarktergebnisse antizipiert werden müssen; im Fall einer Franchise-Ausschreibung ist zumindest die Anzahl der Wettbewerber durch die Ausschreibung selbst gegeben. Daher sind die Einnahmeeffekte, die durch Wettbewerber entstehen, leichter zu berechnen. Zweitens erfordert die Gefahr eines moralischen Risikos des Gewinners detailliertere ex-ante-Regulierungen. Diese erhöhen die sozialen Kosten der universellen Dienstleistungsbereitstellung. Im Vergleich zur direkten Zuweisung von universellen Dienstleistungen mit ex-post Entschädigung verursacht das Ausschreibungsverfahren eine Reihe grundlegender Bedenken und Kompromisse, die die Anwendung von Auktionen in diesem Sektor weniger attraktiv machen als in anderen Bereichen.
Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs

In: Aktuelle Entwicklungen des Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrechts, Band XI, C. Baudenbacher (Hrsg.), Helbing und Lichtenhahn, 337-424
Author: Trinkner Urs
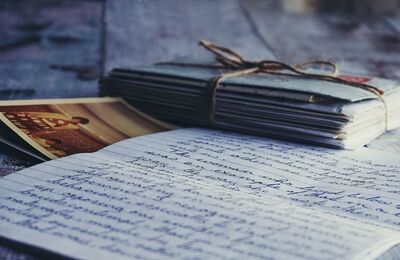
In: Fallstudien zur Netzökonomie, G. Knieps und H.-J. Weiss (Hrsg.), Wiesbaden: Gabler, 87-110
Postsendungen gehören in Europa zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Es handelt sich dabei um adressierte Sendungen, neben Briefsendungen z. B. auch um Zeitungen, Zeitschriften und Postpakete. Im Postbereich wurden gesetzliche Marktzutrittsschranken lange Zeit mit Universaldienstverpflichtungen begründet. Die Einführung des Wettbewerbs in europäischen Postmärkten erfolgte im Rahmen einer graduellen Marktöffnung stufenweise. In der ersten Postrichtlinie (97/67/EG) ist der minimal zu leistende Universaldienst definiert und die allmähliche Einschränkung der Monopole der nationalen Postgesellschaften verankert. Im Rahmen der zweiten Postrichtlinie (2002/39/EG) ist präzisiert, dass Postmonopole in den Mitgliedstaaten nur noch zu dem Grad zulässig sind, wie sie zur Sicherstellung des Universaldienstes dienen. Die dritte Postrichtlinie (2008/6/EG) beinhaltet schliesslich die Pflicht, die vollumfängliche Marktöffnung bis zum Jahr 2011 bei vorgegebenem minimalem Universaldienstniveau in nationales Recht umzusetzen. Vollständig aufgehoben wurde das Monopol auf Briefsendungen bisher von fünf Ländern (Finnland, Schweden, UK, Deutschland und Niederlande). Die übrigen europäischen Mitgliedstaaten werden in Kürze ihre Postmärkte ebenfalls umfassend dem Wettbewerb öffnen.
Autoren: Knieps Günter, Patrick Zenhäusern, Jaag Christian

Journal of Sports Economics 9(4), 339-350
Dieser Artikel stellt ein Modell von Talentinvestitionen vor, bei dem zwei Clubs um Preise konkurrieren. Unser Modell basiert auf einer allgemeinen Klasse von Kostenfunktionen mit einer konstanten Elastizität der Grenzkosten in Bezug auf Investitionen. Die Analyse zeigt, dass eine reduzierte Einnahmenteilung das Wettbewerbsgleichgewicht verbessert. Darüber hinaus zeigen wir, dass eine höhere Elastizität der Grenzkosten in Bezug auf Investitionen das Wettbewerbsgleichgewicht stärkt und gleichzeitig den negativen Effekt der Einnahmenteilung auf das Wettbewerbsgleichgewicht verringert.
Autoren: Grossmann Martin, Dietl Helmut, Trinkner Urs
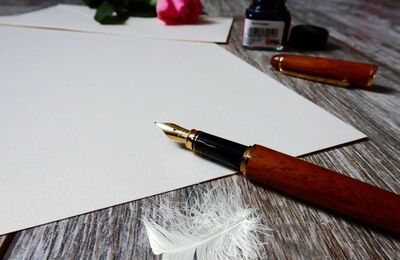
In: Handbook of Worldwide Postal Reform, M. A. Crew, P. R. Kleindorfer und J. I. Campbell Jr. (Hrsg.), Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 80-97
Autoren: Buser Martin, Jaag Christian, Trinkner Urs

In: Competition and Regulation in the Postal and Delivery Sector, Michael A. Crew und Paul R. Kleindorfer (Hrsg.), Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 136-149
Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs

Swiss Journal of Economics and Statistics 143(3), 261-282
Autor: Jaag Christian

In: Liberalization of the Postal and Delivery Sector, edited by M. A. Crew and P. R. Kleindorfer, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 91-101
Autoren: Farsi Mehdi, Filippini Massimo, Trinkner Urs

In: Progress toward Liberalization of the Postal and Delivery Sector, M. A. Crew and P. R. Kleindorfer (Hrsg.), Springer, 267-280
Die Nachfrage nach Post steht vor einer großen Herausforderung. In den letzten Jahren haben sich Substitutionen wie E-Mail und SMS (Short Message Service) als günstige, schnelle und bequeme Alternativen etabliert. In naher Zukunft werden neue, breitbandbasierte Dienste, der Durchbruch der digitalen Signaturen, vollständig webbasierte Zahlungssysteme und Vertragslösungen die Postbranche weiter beeinflussen. In der Schweiz erreichte die gesamte adressierte Post im letzten Quartal des Jahres 2000 ihren Höhepunkt, wie in Abbildung 1 gezeigt. Seitdem schrumpfen die Postvolumen. Es ist jedoch nicht klar, ob die E-Substitution die zugrunde liegende Ursache war oder ob dies auf einen anderen Faktor wie die wirtschaftliche Verlangsamung in der Schweiz zwischen 2001 und 2003 zurückzuführen war.
Autoren: Trinkner Urs, Grossmann Martin

In: Regulatory and Economic Challenges in the Postal and Delivery Sector, M. A. Crew and P. R. Kleindorfer (Hrsg.), Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 53-72
Autoren: Dietl Helmut, Trinkner Urs, Bleisch Reto
Autres

Panel Presentation Energieforschungsgespräche Disentis 2025
Dynamische Stromtarife werden als ein wichtiges Element der Energiewende angesehen. Der Vortrag von Urs Trinkner umfasst Erkenntnisse zur Preiselastizität der Nachfrage und Ansätze zur Verringerung der Preisrisiken für Endkunden, die sich für variable Tarife entscheiden.

Energiewirtschaftliche Tagesfragen 12/2024, Seiten 57-63
Dynamische Stromtarife werden als wichtiges Element in der Transformation der Energiewirtschaft gesehen. Bislang sind sie in Deutschland und der Schweiz noch kaum verbreitet. In diesem Beitrag werden ihre systemischen Eigenschaften und Ansätze zur Reduktion der preislichen Risiken der Endkunden beschrieben, die zu einer besseren Akzeptanz der dynamischen Stromtarife führen können.
Autoren: Wolfgang Elsenbast, Urs Trinkner, Christian Winzer

Neue Zürcher Zeitung, 31. Oktober 2024
Die Gesamtkosten des Schweizer Gesundheitswesens nähern sich rasch der Marke von 100 Milliarden Franken pro Jahr. Nun stimmt die Schweiz am 24. November über einen weiteren Reformschritt ab. Aber der wird nicht genügen. Es braucht neue Ideen.
Artikel: NZZ Online, Print.
Autoren: Romain de Luze, Alix Rey

Neue Zürcher Zeitung, 10. Juli 2024
Ist die aktuelle Praxis der WEKO in Bezug auf die Prüfung der vertikalen Abreden sinnvoll? Sind überhaupt alle vertikalen Abreden zwingend schädlich? In ihrem NZZ-Gastbeitrag gehen die Autoren diesen Fragen nach.
Artikel: NZZ Online, Print.
Autoren: Dr. Samuel Rutz, Dr. Stefan Bühler

Neue Zürcher Zeitung, 26. Juni 2024
Ist die Angleichung der Schweizer Gesetzgebung in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung an die EU-Regeln sinnvoll? In ihrem NZZ-Gastbeitrag beleuchten die Autoren diese Frage vor allem aus der Perspektive der Schweizer KMUs.
Artikel: NZZ Online, Print.
Autoren: Dr. Samuel Rutz, Dr. Beat Brechbühl

Swiss Economics Blog
Dieser Blogbeitrag ist der erste in unserer Blogreihe über Uniswap. In diesem Artikel geben wir eine kurze Einführung in die Funktionsweise von Uniswap und legen die Definition grundlegender wirtschaftlicher Begriffe im Zusammenhang mit seinem Mechanismus fest.

Die Volkswirtschaft, Februar 2024
Konsumenten reagieren auf Preisanpassungen – auch beim Strom. Das Problem: Die Preisschwankungen dringen meist nicht bis zu ihnen durch. Flexiblere Tarifmodelle könnten den Energieverbrauch effizienter und damit ökologischer machen.
Autoren: Nicolas Eschenbaum, Urs Trinkner

Swiss Economics Blog
Die Fluggesellschaftsbranche war eine der ersten, die viele moderne technologische Fortschritte übernommen hat, wie zum Beispiel die Nutzung von automatisierten abhängigen Überwachungsfunktionen, GPS und Radar. Im Vergleich zu den modernen Tech-Giganten erscheinen Fluggesellschaften jedoch als „die alte Garde“, schwerfällige Unternehmen mit veralteter Technologie.

Swiss Economics Blog
Diese Blog ist der Letzte in unserer Krypto-Staking Blog Serie. Der erste Blog zu der Ökonomie hinter Krypto-Staking befindet sich hier und der zweite Blog, mit einem ökonomischen Vergleich des Stakings über Blockchains hinweg, hier.

Swiss Economics Blog
Die neu eingeführten und bereits teilweise umgesetzten FIFA-Regelungen für Fußballagenten (FFAR) haben eine Kontroverse ausgelöst, die noch nicht beigelegt ist. Wie weit darf – und sollte – der internationale Dachverband der weltweit beliebtesten Sportart den Wettbewerb auf dem Markt der Fußballagenten einschränken dürfen?

Swiss Economics Blog
Die Entschädigung für unentgeltlichen Rechtsschutz im Asylwesen setzt keine Anreize, Beschwerden einzureichen.

Swiss Economics Blog
Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) bieten ungeahnte Möglichkeiten betreffend der Digitalisierung und Automatisierung von Alltagsprozessen. Während KI schon seit Jahren zur Automatisierung genutzt wird und aus vielen Produkten nicht wegzudenken ist, kommt diese Entwicklung mit Algorithmen wie ChatGPT jetzt endgültig im menschlichen Alltag an. Unter den «KI-Hype» mischen sich aber auch grosse Ängste. Von verschiedenen Seiten wurden bereits Moratorien der KI-Entwicklung gefordert aus Sorge, dass KI entwickelt wird, die sich nicht mehr verstehen und kontrollieren lässt.
Weniger Beachtung findet hingegen das Wettrennen der grossen Internetkonzerne um die Vorherrschaft im KI-Markt, dessen Ergebnis unseren Lebensalltag aber prägen wird. Beispielsweise rief Google nur wenige Tage nach dem Release von ChatGPT intern einen «Code Red» aus – das Unternehmen fürchtete um seine Einnahmen aus dem Suchmaschinen-Business – und bereitete den Release einer konkurrierenden KI vor (genannt «Bard»). Dieses Wettrennen von «Big-Tech» zeigt, wie hoch der Wert von KI wie ChatGPT eingeschätzt wird.

Die Volkswirtschaft, 11. Juli 2022
Chatbots wie ChatGPT basieren auf künstlicher Intelligenz und schaffen unbestritten gesellschaftlichen Mehrwert. Sie gehen aber gleichzeitig mit wettbewerblichen Herausforderungen einher. Die Gewinner des Wettrennens der grossen Internetkonzerne um die Vorherrschaft im KI-Markt werden unseren Lebensalltag voraussichtlich entscheidend mitgestalten.
Autoren: Nicolas Eschenbaum, Samuel Rutz, Michael Funk
Liken, Teilen oder Kommentieren auf Linkedin

Swiss Economics Blog
Umweltpolitik ist ein wesentliches Instrument zur Bewältigung globaler Umweltprobleme. Eine der zentralen Herausforderungen, mit denen sich politische Entscheidungsträger bei der Gestaltung von Umweltmaßnahmen konfrontiert sehen, ist deren potenzieller Einfluss auf den technologischen Wandel. Die entscheidende Frage lautet: Können Umweltpolitiken die Entwicklung umweltfreundlicherer Technologien fördern? Calel und Dechezleprêtre [1] untersuchen den Zusammenhang zwischen Umweltpolitik und gezieltem technologischen Wandel im Kontext des Europäischen Emissionshandelssystems (EU ETS). Derzeit ist das EU ETS das größte Emissionshandelssystem der Welt. Zahlreiche Länder haben bereits ein solches System eingeführt oder diskutieren dessen Einführung. Im Jahr 2011 hatten die globalen Kohlenstoffmärkte einen Wert von über 175 Milliarden US-Dollar. Laut dem Bericht „State and Trends of Carbon Pricing“ der Weltbank [2] ist der Anteil der weltweiten Treibhausgasemissionen, der durch CO₂-Bepreisungssysteme abgedeckt wird, von 5 % im Jahr 2011 auf 23 % im Jahr 2022 gestiegen.

Swiss Economics Blog
Seit Jahren arbeitet die EU an einem Gesetz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz, dem AI Act. Im Zuge der jüngsten Entwicklungen um "ChatGPT" wurde der Entwurf des AI Acts noch einmal stark überarbeitet und am 14.06.2023 vom Europäischen Parlament verabschiedet. Im folgenden zwei aus wettbewerbsökonomischer Perspektive interessante Aspekte des AI Acts.

Swiss Economics Blog
In diesem ersten Blogbeitrag erklären wir die grundlegenden Begriffe, wirtschaftlichen Zusammenhänge und Mechanismen von Staking-Designs. Anschließend vergleichen wir die Staking-Modelle von neun verschiedenen Blockchains.

Swiss Economics Blog
Trotz der Omnipräsenz des Begriffs der Digitalisierung wird dieser selten schlüssig definiert.

Swiss Economics Blog
In einem Beitrag für cash.ch diskutieren Helmut Dietl und Matthias Hafner das Potenzial des Ethereum Merge.
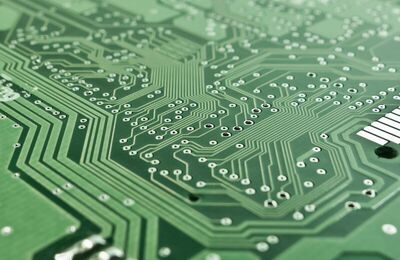
Swiss Economics Blog
Immer mehr Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden äussern Bedenken beim Einsatz von KI im Marktwettbewerb. Die Liste ist lang und umfasst Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich oder die Niederlande. Dementsprechend ist damit zu rechnen, dass Unternehmen, die KI einsetzen, in den kommenden Jahren immer genauer unter die Lupe genommen werden.
Doch welche Wettbewerbsnachteile können durch KI ausgelöst werden? Unser Team von Experten für digitale Märkte und KI hat das umfangreiche Feld der Auswirkungen von KI auf den Wettbewerb hier in einem einfachen Überblick für drei mögliche Marktumgebungen zusammengefasst.

Die Volkswirtschaft, 23. Juni 2022
Der Bundesrat will Start-ups in der frühen Wachstumsphase mit einem Innovationsfonds stärken. Vier Modelle kommen dafür in Frage, die jeweils eigene Stärken und Schwächen haben. Die Modellwahl ist letztlich politisch und sollte mit einer genauen politischen Zieldefinition gemäss dem Prinzip «Form Follows Function» beginnen .
Autoren: Matteo Mattmann, Urs Trinkner, Dietmar Grichnik, Michael Greger
Liken, Teilen oder Kommentieren auf Linkedin

Swiss Economics Blog
In einem Blog-Artikel an der Hochschule St.Gallen hat unser Mitarbeiter Nicolas Greber beleuchtet, wie sich die 2018 in der Europäischen Union eingeführte Datenschutz-Grundverordnung ausgewirkt hat.

Swiss Economics Blog
Ausländische Verfahren deuten darauf hin, dass Google seine starke Marktstellung in der Werbevermittlung nicht nur überragender Technologie und Innovation verdankt. Weshalb dies auch für die Schweiz von Relevanz ist.

Die Volkswirtschaft, 12/2021, S. 61
Ineffizienzen und Überbehandlungen machen rund ein Fünftel der Gesundheitskosten aus. Der Bundesrat will deshalb mit einer Zielvorgabe Fehlanreize beseitigen. Eine Analyse bescheinigt dem Instrument hohe Kosteneinsparungen, macht aber gleichzeitig deutlich, dass das nicht reicht.
Zum Artikel (Deutsch/Französisch)

Neue Zürcher Zeitung, 3. Dezember 2021
Geht es nach Bundesrat und Parlament, soll in der Schweiz künftig jeder als Organspender gelten, sofern er dies nicht schriftlich abgelehnt hat. Dahinter steckt die Idee, dass ein "Opt-out-System" im Vergleich zu einem "Opt-in-System" zu mehr Spendeorgane führt. Unser NZZ-Artikel zeigt, dass dem nicht so ist. Denn auch in einem Opt-out-System entscheiden in der Regel die Angehörigen der verstorbenen Person, sofern keine schriftliche Willensbekundung vorliegt. Damit unterscheiden sich die beiden Lösungen weit weniger, als auf den ersten Blick zu erwarten ist.
Autoren: Ann-Kathrin Crede und Matteo Mattmann

Swiss Economics Blog

Swiss Economics Blog
Das Staken der Kryptowährung Ether ist für langfristig orientierte Anleger durchaus attraktiv. Doch wie funktioniert das Staken? Und mit wieviel Zins pro Jahr kann man rechnen?

Swiss Economics Blog
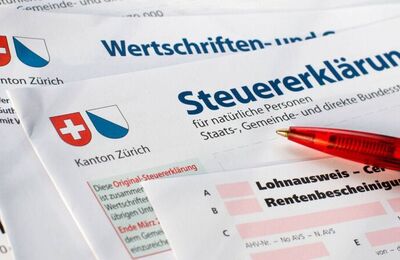
Swiss Economics Blog
Wir alle schieben Dinge vor uns her: Eine verhaltensökonomische Perspektive auf das Thema Prokrastinationsverhalten.

Swiss Economics Blog
Das Tiefbauamt des Kantons Bern screent seit Mitte 2020 Beschaffungen von Baumeisterleistungen im offenen Verfahren nach Hinweisen auf mögliche Submissionsabreden. Über ein Software-basiertes Screening-Tool werden Angebote auf Auffälligkeiten bezüglich ihrer Höhe, Ausgestaltung, Verteilung und Anzahl hin untersucht. Scheinen normale wettbewerbliche Bedingungen unwahrscheinlich, werden weitere Abklärungen getroffen und Massnahmen ergriffen, bis zu einer Anzeige bei der Wettbewerbskommission. Damit setzt das Amt ein klares Zeichen gegen Kartelle im Bauwesen und für einen effizienten Umgang mit Steuergeldern. Swiss Economics unterstützte das Amt bei der Entwicklung und Einführung des Screening Tools.

Swiss Economics Blog
In früheren Blogbeiträgen haben wir uns bereits mit verschiedenen Themen zur Coronakrise und Verhaltensökonomie beschäftigt. In diesem Beitrag geht es um die Frage, wie Leute (freiwillig) zur Covid-19-Impfung bewegt werden können.

Swiss Economics Blog
In früheren Blogeinträgen haben wir uns bereits mit verschiedenen Themen zur Coronakrise und Verhaltensökonomik beschäftigt. In diesem Beitrag geht es um die SwissCovid App und wie deren Nutzung mit #Gamification gefördert werden könnte.

Swiss Economics Blog
In unseren bisherigen Beiträgen zu Verhaltensökonomik und Coronakrise haben wir uns mit folgenden Themen beschäftigt: #StayHome als Beitrag zu einem öffentlichen Gut, der Psychologie von Hamsterkäufen, der grossen Wirkung von kleinen Massnahmen, der Rolle von Referenzpunkten für die Wahrnehmung der Lockerungsmassnahmen, dem #MoralDilemma zwischen knappen Ressourcen und dem unantastbaren Wert eines Menschenlebens sowie #HomeOffice und welche Rolle Vertrauen und Reziprozität dabei spielen. In diesem Beitrag geht es um die Bedeutung von Framing für die Einhaltung der #Quarantäne.

Swiss Economics Blog
Viele junge Arbeitnehmer, insbesondere Studienabgänger, absolvieren Praktika als Teil ihrer Ausbildung oder als Einstieg ins Berufsleben. Dass der Lohn häufig tief ausfällt, ist weithin bekannt und wird regelmässig diskutiert. Die unterschiedliche Höhe von Praktikantenlöhnen zwischen, aber auch innerhalb von Branchen, sind gross. Wie lassen sich Praktikantenlöhne ökonomisch erklären und was ist eigentlich ein fairer Lohn für Praktikanten?

Die Volkswirtschaft, 7/2020, S. 50-52
Mit der Fair-Preis-Initiative will das Initiativkomitee gegen Preisdifferenzierung von ausländischen Firmen in der Schweiz vorgehen. Sie will im Schweizer Wettbewerbsrecht neu die «relative Marktmacht» von Unternehmen verankern. In der Öffentlichkeit wird die Initiative dann auch gerne als Instrument gegen die «Hochpreisinsel Schweiz» angepriesen. Auf technischer Ebene soll mittels der Initiative das Konzept der relativen Marktmacht im Kartellgesetz eingeführt werden. Dies würde jedoch zu einer unheilvollen Vermischung von Wettbewerbs- und Strukturpolitik führen. Klar ist zudem heute schon, dass die Initiative überhöhte Hoffnungen schürt, da deren Umsetzung in der Praxis mit fast unüberwindbaren Herausforderungen verbunden wäre. Auch würde die Schweiz mit der Annahme der Initiative international einen unerprobten Sonderweg einschlagen. Das Konzept ist aus ökonomischer Sicht ungeeignet, um die hohen Preise in der Schweiz zu bekämpfen. Der Nationalrat hat sich für einen Gegenvorschlag ausgesprochen, der sich sehr nahe an der ursprünglichen Initiative orientiert. Noch hat der Ständerat aber die Möglichkeit ein klares Zeichen gegen die Fair-Preis-Initiative zu setzen.
Autoren: Samuel Rutz und Christian Jaag

Swiss Economics Blog
In unseren bisherigen Beiträgen zu Verhaltensökonomik und Coronakrise haben wir uns mit folgenden Themen beschäftigt: #StayHome als Beitrag zu einem öffentlichen Gut, der Psychologie von Hamsterkäufen, der grossen Wirkung von kleinen Massnahmen, der Rolle von Referenzpunkten für die Wahrnehmung der Lockerungs-massnahmen und dem #MoralDilemma zwischen knappen Ressourcen und dem unantastbaren Wert eines Menschenlebens. Im nachfolgenden Beitrag geht es um #HomeOffice und welche Rolle Vertrauen und Reziprozität dabei spielen.

Swiss Economics Blog
Im Wirtschaftsmagazin ECO des Schweizer Fernsehens gab Michael Funk Auskunft zu den Risiken und Chancen von Airbnb in der Corona-Krise.

Oekonomenstimme, 18.5.2020
Tobias Binz, Christian Jaag und Samuel Rutz untersuchen in einem Artikel in der Oekonomenstimme die unterschiedlichen Reaktionen von Wettbewerbsbehörden auf die Corona-Krise.
Autoren: Tobias Binz, Christian Jaag, Samuel Rutz

Finanz und Wirtschaft, 6.5.2020
Matteo Mattmann und Samuel Rutz legen in einem Gastbeitrag für die Finanz und Wirtschaft dar, weshalb sich kantonale Unterstützungspakete an klar definierten Zielen orientieren sollen.
Autoren: Matteo Mattmann, Rutz Samuel

Swiss Economics Blog
In unseren bisherigen Beiträgen zu Verhaltensökonomik und Coronakrise haben wir uns mit #StayHome als Beitrag zu einem öffentlichen Gut, der Psychologie von Hamsterkäufen, der grossen Wirkung von kleinen Massnahmen und der Rolle von Referenzpunkten für die Wahrnehmung der Lockerungsmassnahmen beschäftigt. Im nachfolgenden Beitrag geht es um den Konflikt zwischen knappen Ressourcen und dem unantastbaren Wert eines Menschenlebens.

Swiss Economics Blog
In unseren bisherigen Beiträgen zu Verhaltensökonomik und Coronakrise haben wir uns mit #StayHome als Beitrag zu einem öffentlichen Gut, der Psychologie von Hamsterkäufen und der grossen Wirkung von kleinen Massnahmen beschäftigt. Im nachfolgenden Beitrag geht es um die Frage, wie wir die schrittweise Lockerung der Massnahmen zum Schutz vor dem neuen Coronavirus wahrnehmen und was das mit Referenzpunkten zu tun hat.

Handelszeitung, 7.4.2020
Kommentar von Urs Trinkner in der Handelszeitung, wann und wie der Bundesrat gestützt auf die aktuellen COVID-19 Fallzahlen seine Lockdown-Massnahmen lockern könnte.
Kommentieren/Liken/Sharen auf Linkedin

Swiss Economics Blog
Preise widerspiegeln bekanntlich Informationen über Angebot und Nachfrage. Dadurch kommt ihnen eine wichtige Funktion in der Koordination von Produktions- und Konsumplänen zu. Hohe Preise signalisieren, dass ein Gut knapp ist. Dies beeinflusst die Anreize der Marktteilnehmer: Die Produzenten erhöhen ihre Produktionsmenge, während die Konsumenten ihre Nachfrage reduzieren. Preise sorgen also dafür, dass sich Angebot und Nachfrage ausgleichen.
Die beschriebene Lenkungsfunktion des Preismechanismus funktioniert allerdings nur, wenn sich die Preise frei im Wettbewerb bilden können.

Swiss Economics Blog
In unseren ersten beiden Beiträgen zu Verhaltensökonomik und Coronakrise haben wir uns mit #StayHome als Beitrag zu einem öffentlichen Gut und der Psychologie von Hamsterkäufen beschäftigt (#VolleRegale). Im nachfolgenden Beitrag geht es um die grosse Wirkung von kleinen Massnahmen und wie deren Einhaltung gefördert werden kann.
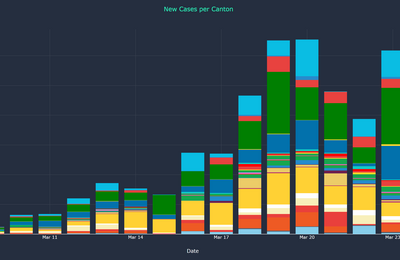
Swiss Economics Blog
Die kumulierten Fallzahlen von positiven COVID-19 Tests sind in den Medien allgegenwärtig. In diesen Graphiken schwierig abzulesen ist die Entwicklung der täglichen Neuansteckungen.

Swiss Economics Blog
In unserem ersten Beitrag haben wir uns mit #StayHome als Beitrag zu einem öffentlichen Gut beschäftigt. Im nachfolgenden Beitrag geht es um die verhaltensökonomische Betrachtung von Hamsterkäufen und wie man diesen begegnen kann. #VolleRegale

Swiss Economics Blog
Bereits heute ist klar: die wirtschaftlichen Schäden von Covid-19 werden ein riesiges Ausmass annehmen. Die Umsatzeinbrüche fallen teils so massiv aus, dass in gewissen Branchen auch führende Unternehmen um ihr Überleben fürchten müssen. Besonders trifft es Industrien, die Menschen miteinander in Kontakt bringen. Viele der betroffenen Unternehmen, insbesondere aus der Reisebranche, Unterhaltungsindustrie und Gastronomie, werden die entstandenen Schäden nicht allein stemmen können. Bereits hat die Politik die Möglichkeiten zur Kurzarbeit ausgedehnt und umfangreiche Liquiditätshilfen bereitgestellt. Viele Firmen werden jedoch zusätzlich auf Kulanz seitens Zulieferer oder Vertragspartner angewiesen sein.

Swiss Economics Blog
Welche Implikationen ergeben sich aus dem Trade-off zwischen Ökonomie und Gesundheit für politische Entscheidungsträger in Anbetracht der Corona Pandemie?

Swiss Economics Blog
Die weltweite Ausbreitung des neuen Coronavirus hat die Regierungen gezwungen, flächendeckende Verhaltensregeln aufzustellen und deren Einhaltung mit teilweise rigorosen Massnahmen durchzusetzen. Die neue Situation erfordert grosse Anstrengungen eines jeden Einzelnen. Der Mensch handelt aber nicht immer völlig rational, das hat die Forschung aus der Verhaltensökonomik stichhaltig und evidenzbasiert gezeigt. In einer Ausnahmesituation wie der jetzigen, in der sich Menschen innerhalb kürzester Zeit in einem neuen Alltag zurechtfinden und angeordnete Verhaltensregeln umsetzen müssen, kommt dies besonders zum Vorschein. Mithilfe verhaltensökonomischer Erkenntnisse lassen sich augenscheinlich irrationale menschliche Entscheidungen erklären und besser verstehen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, effektivere Massnahmen zur Prävention und Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus abzuleiten.

Präsentation bei CV Labs, 5/2019.
Die Plattform für Blockchain und Kryptowährungen von Swiss Economics (cryptecon) ist mit CV VC, dem grössten Venture Capital Unternehmen für Blockchain-Startups in der Schweiz, eine Partnerschaft eingegangen. Im Rahmen dieser Partnerschaft haben Christian Jaag und Matthias Hafner die Startups des CV Labs Inkubationsprogramm getroffen und mit ihnen ihre Erfahrungen im Bereich Plattformökonomie und Geldtheorie ausgetauscht. Den Teilnehmern des Workshops wurden die wichtigsten ökonomischen Grundlagen und Entscheide, die beim Design von Blockchain-Projekten zu berücksichtigen sind, vermittelt.

Die Volkswirtschaft, 6/2019, S. 4-7.
Wasser ist aus ökonomischer Sicht kein öffentliches Gut. Gleichwohl kann die leitungsgebundene Wasserversorgung nicht unbesehen den Marktkräften überlassen werden, da insbesondere beim Verteilnetz ein «monopolistischer Engpass» besteht. Die Ausgangslage präsentiert sich ähnlich wie bei Strom-, Gas- und Schienennetzen: Entweder erbringt die öffentliche Hand die gewünschte Versorgung selbst, oder sie übergibt diese an öffentliche oder private Leistungserbringer. Im zweiten Fall gewährleistet er die Qualität der Wasserversorgung durch Regulierung. Aus ökonomischer Sicht sind beide Wege gangbar. Für Schweizer Gemeinden, die über eine gute direktdemokratische Kontrolle verfügen, kann die öffentliche Eigenerbringung vorteilhaft sein.
Autoren: Samuel Rutz, Urs Trinkner

Umweltschutz der Wirtschaft, Ausgabe 4/18-19, S. 33-34
Im Artikel diskutieren Urs Trinkner und Martin Lutzenberger Ansätze zur wirksamen Umsetzung der Anreizregulierung für Verteilernetzbetreiber Strom in Österreich.
Autoren: Trinkner Urs, Lutzenberger Martin

Neue Zürcher Zeitung
In einem Gastkommentar in der Neuen Zürcher Zeitung legen Tobias Binz und Samuel Rutz dar, wieso die schweizerische Fusionskontrolle modernisiert werden muss.
Autoren: Tobias Binz, Samuel Rutz

Vor & Nachteil der Schweizer Erfahrung
Autor: Michael Funk

Beitrag in der Neuen Zürcher Zeitung.
Die «Fair-Preis-Initiative» wird als Heilmittel gegen die Hochpreisinsel Schweiz angepriesen. Das Konzept der relativen Marktmacht stellt einen massiven Eingriff in die Wirtschafts- und Entscheidungsfreiheit der Unternehmen dar. Samuel Rutz und Christian Jaag legen in einem Gastkommentar der NZZ dar, dass die «Fair-Preis-Initiative» nicht zielführend ist.
Autoren: Christian Jaag, Samuel Rutz

Neue Zürcher Zeitung
Ein Beitrag von Michael Funk und Samuel Rutz in der NZZ zeigt, dass die kartellrechtlichen Eingriffshürden bei Abreden und Fusionen im Schweizer Wettbewerbsrecht auseinander driften.
Autoren: Michael Funk, Samuel Rutz

Die Volkswirtschaft, 10-2017, pp. 58-59
Digitale Märkte erfordern keine neue Gesetzgebung. Vielmehr verlangt das Verhalten der Unternehmen im Einzelfall nach einer genauen Analyse. Oftmals sind die wettbewerblichen Auswirkungen nämlich ambivalent.
Autoren: Christian Jaag, Samuel Rutz

Presentation von Christian Jaag
Christian Jaag hat an der PostExpo 2017 zum Thema «Postal regulation - Past & Future» referiert.

Presentation von Christian Jaag
Christian Jaag hat an der PostExpo 2017 zum Thema «Postcoin - The future of postal payments?» referiert.
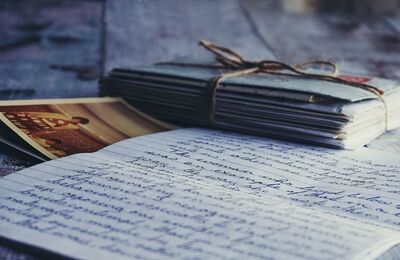
Neue Zürcher Zeitung
Der Bundesrat hat anfangs Jahr einen Bericht zur Evaluation des Postgesetzes vorgelegt. Ein Beitrag von Christian Jaag und Samuel Rutz in der NZZ vom 15.2.2017 setzt sich kritisch damit auseinander.
Autoren: Jaag Christian, Rutz Samuel
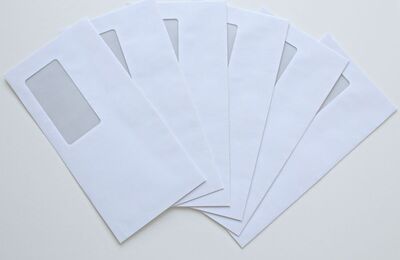
Network Industries quarterly, vol. 17(3), pp. 10-13
Autoren: Jaag Christian, Moyano Jose Parra, Trinkner Urs

Die Volkswirtschaft 1/2-2015, pp. 58-61
Autoren: Trinkner Urs, Scherrer Ivo

Die Volkswirtschaft 7/8-2014, pp. 34-37
Autoren: Finger Matthias, Trinkner Urs

Pharmaceutical Dialogue, No 32, 4
Autor: Koller Martin

Die Volkswirtschaft 3-2012, pp. 14-17
Autor: Jaag Christian

Die Volkswirtschaft 04-2011, 43-46
Im Dezember 2010 haben die eidgenössischen Räte die neue Postgesetzgebung verabschiedet. Die vorliegenden Überlegungen stellen diese Reform in den Kontext der aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Postsektor. Dabei wird aufgezeigt, in welchem Spannungsfeld sich die Postgesetzgebung befindet und welche Zielkonflikte sich dahinter verbergen. Heute prägen drei langfristig zentrale Trends den Postsektor: Liberalisierung, Globalisierung und Digitalisierung. Sie sind Anlass für die Totalrevision der Postgesetzgebung. Dadurch wird die bisherige Sonderstellung der Post relativiert; gleichwohl bleibt sie als Grundversorgerin im Besitz des Bundes auch künftig ein Unternehmen, das vielfältigen politischen Ansprüchen gerecht werden muss.
Autoren: Dietl Helmut, Jaag Christian, Trinkner Urs
DE: Zur Publikation

Network Industries Quarterly 12(3), 17-19
Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs
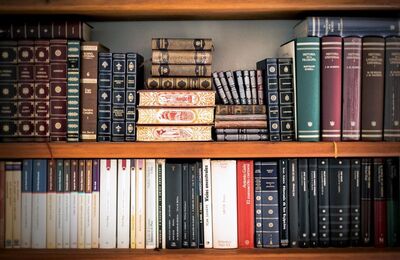
Postal Technology International: 2011 Annual Showcase, 41-43
Autoren: Jaag Christian, Mägli Martin

Die Volkswirtschaft 11-2009, 46-50
Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs

Network Industries Quarterly 11(4), 6-18
Autoren: Jaag Christian, Lutzenberger Martin, Trinkner Urs

Network Industries Quarterly 11(3), 3-6
Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs

Die Volkswirtschaft 1/2-2009, 67-70
Autoren: Jaag Christian, Keuschnigg Mirela
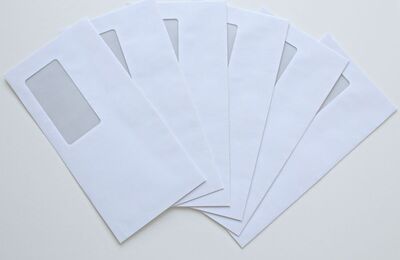
Network Industries Quarterly 10(1), 18-19
Aus verschiedenen Gründen fordern die meisten Akteure auf liberalisierten Postmärkten Sektor spezifische Regulierungsbehörden. Diese sollten jedoch im Laufe der Zeit verschwinden, zusammen mit einer zunehmend marktorientierten Definition von Universaldiensten.
Autoren: Finger Matthias, Trinkner Urs

Die Volkswirtschaft 5-2007, 10-13
Autoren: Jaag Christian, Trinkner Urs
Blogs
von Thunj Chantramonklasri

Unsiwap und Liquidität Versorgung
Zum Beitrag …
von Beatrix Marosvölgyi

Blockchain und KI in der Luftfahrt Industrie
Zum Beitrag …
von Nicolas Oderbolz, Beatrix Marosvölgyi, Matthias Hafner

Dynamische vs. Statische Sicherheit in Staking-Designs
Zum Beitrag …
von Ramon Gmür, Michael Funk

Spieleragenten vs. FIFA – Zum Wohle des Spiels?
Zum Beitrag …
von Helmut Dietl, Christian Jaag

Anreizwirkung der pauschalen Abgeltung für die Rechtsvertretung im Asylverfahren
Zum Beitrag …
von Nicolas Eschenbaum

Generative KI und Marktwettbewerb
Zum Beitrag …
von Michael Altorfer

KÖNNEN UMWELTPOLITIKEN DIE ENTWICKLUNG UMWELTFREUNDLICHER TECHNOLOGIEN FÖRDERN?
Zum Beitrag …
von Nicolas Eschenbaum

Ein wettbewerbsökonomischer Blick auf den AI Act
Zum Beitrag …
von Nicolas Oderbolz, Beatrix Marosvölgyi, Matthias Hafner

Die Ökonomie des Krypto-Stakings
Zum Beitrag …
von Ramon Gmür, Urs Trinkner

Definition der Digitalisierung
Zum Beitrag …
von Helmut Dietl, Matthias Hafner

Das ökonomische Potenzial des Ethereum Merge
Zum Beitrag …
von Nicolas Eschenbaum, Nicolas Greber, Michael Funk
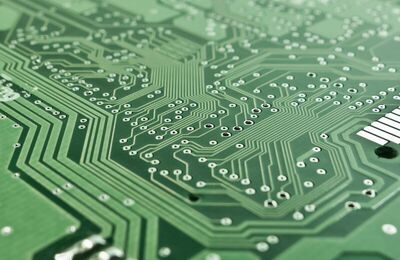
Die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf den Wettbewerb
Zum Beitrag …
von Nicolas Greber

Neue Datenschutzverordnung in der EU: Gewinner und Verlierer
Zum Beitrag …
von Michael Funk

Hoffen auf fremde Richter im Fall Google
Zum Beitrag …
von Samuel Rutz

Krankenkassenwechsel: Warum die meisten Versicherten freiwillig auf Geld verzichten
Zum Beitrag …
von Helmut Dietl

Ether Staken
Zum Beitrag …
von Ann-Kathrin Crede, Felix Wüthrich

Eine neue Methodik zur Messung umweltfreundlichen Verhaltens - Der «Carbon Emission Task»
Zum Beitrag …
von Ann-Kathrin Crede
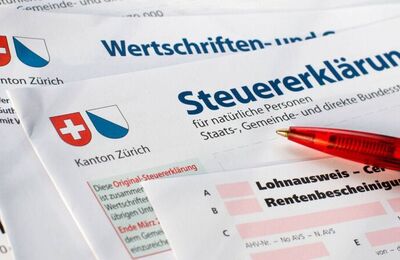
Was du heute kannst besorgen ... Steuererklärung und Prokrastinationsverhalten
Zum Beitrag …
von Tobias Binz, Christian Jaag

Screening nach Submissionsabreden im Strassen- und Tiefbau
Zum Beitrag …
von Ann-Kathrin Crede

Wie können Leute (freiwillig) zur Covid-19-Impfung bewegt werden?
Zum Beitrag …
von Ann-Kathrin Crede

Die Nutzung der SwissCovid App mit #Gamification fördern
Zum Beitrag …
von Ann-Kathrin Crede

Die Bedeutung von Framing für die Einhaltung der #Quarantäne
Zum Beitrag …
von Felix Wüthrich

Praktikalöhne aus ökonomischer Perspektive
Zum Beitrag …
von Ann-Kathrin Crede

Die Rolle von Vertrauen und Reziprozität für #HomeOffice
Zum Beitrag …
von Michael Funk

Sharing Economy: Verhalten von Airbnb
Zum Beitrag …
von Ann-Kathrin Crede

Knappe Ressourcen und der Wert eines Menschenlebens #MoralDilemma
Zum Beitrag …
von Ann-Kathrin Crede

Referenzpunkte und die Wahrnehmung der Lockerungen #ExitStrategy
Zum Beitrag …
von Melanie Häner

Der Preismechanismus und seine Grenzen
Zum Beitrag …
von Ann-Kathrin Crede

Nudges - Kleine Massnahmen mit grosser Wirkung #WashYourHands
Zum Beitrag …
von Urs Trinkner
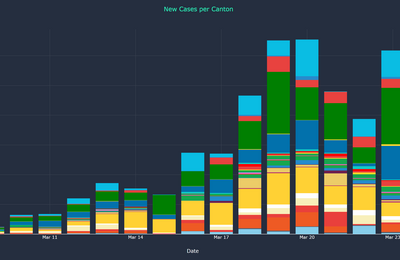
COVID-19 Neuansteckungen in der Schweiz: Die Massnahmen des Bundesrates zeigen Wirkung
Zum Beitrag …
von Ann-Kathrin Crede

Kein Grund für Hamsterkäufe #VolleRegale
Zum Beitrag …
von Tobias Binz

Bemessung von Covid-19 Schäden für Unternehmen und Betriebe
Zum Beitrag …
von Matteo Mattmann

Internationale Corona-Policies: Der Versuch einer Kategorisierung
Zum Beitrag …
von Ann-Kathrin Crede

#StayHome als Beitrag zu einem öffentlichen Gut
Zum Beitrag …
Swiss Economics Research Papers in Economics
Nos trois séries RePec (Research Papers in Economics) :